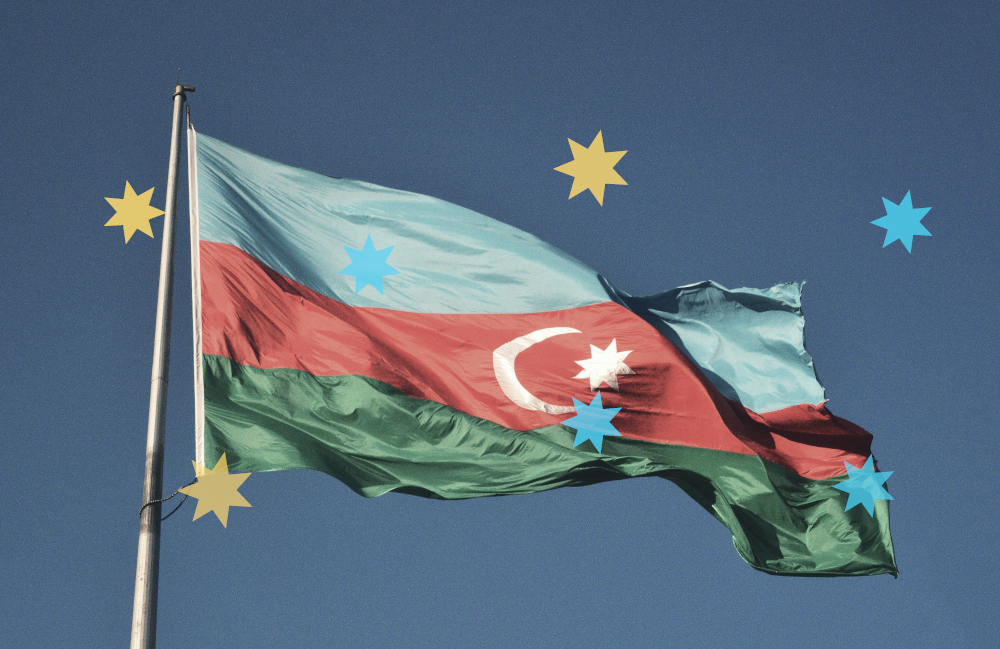750 Milliarden gegen die Corona-Krise: Darauf haben sich die EU-Spitzen Dienstagfrüh nach langen Verhandlungen geeinigt. Wie viel Geld ist das eigentlich? Was hat es mit der Inszenierung von Sebastian Kurz auf sich? Und werden wir nun die Coronakrise solidarisch bewältigen? Lisa Mittendrein beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den EU-Gipfel.
Was wurde beim EU-Gipfel am Wochenende beschlossen?
Nächtelang haben die Staats- und Regierungschef*innen über das EU-Budget für die nächsten Jahre (2021-2027) und neue EU-Maßnahmen gegen die Coronakrise verhandelt. Schließlich haben sie im Wesentlichen das beschlossen, was Angela Merkel und Emmanuel Macron sowie zuletzt die EU-Kommission vorschlugen: Die EU weitet ihr Budget aus und die Mitgliedstaaten erhalten zur Bewältigung der Krise Kredite und Beihilfen von der EU-Kommission. Dafür gibt es etwa 750 Milliarden Euro – etwa zur Hälfte (rückzahlbare) Kredite und (nicht rückzahlbare) Beihilfen. Dieser sogenannte Aufbauplan wird an Auflagen geknüpft – mehr dazu später. Die EU finanziert das Ganze, indem sie an den Finanzmärkten Geld aufnimmt.
Das klingt nach viel Geld. Kann damit die Coronakrise wirksam bekämpft werden?
Eher nicht. 750 Milliarden mag nach viel klingen, sind für die gesamte EU aber angesichts der Tiefe der Krise wenig – vor allem über mehrere Jahre. Wirklich bedeutsam sind auch nur die 390 Milliarden an Beihilfen, denn günstige Kredite bekommen die Mitgliedstaaten derzeit dank der EZB-Politik auch anderswo.
Die neuen Beihilfen machen insgesamt für drei Jahre etwa 0,7 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung aus. Diese bricht alleine heuer jedoch um voraussichtlich 8,3 Prozent ein. Die Mittel sind also gering und können frühestens ab nächstem Jahr fließen, vielleicht sogar noch später. Doch gerade beim Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der angeblich mit den Corona-Mitteln vorangetrieben werden soll, dürfen wir keinerlei Zeit verlieren.
Wäre es nur zu wenig Geld, so würde der EU-Plan vielleicht nicht viel helfen, aber dafür auch keinen Schaden anrichten. Doch die Gefahr ist groß, dass die Länder einen hohen Preis für die Beihilfen zahlen müssen.
Warum sollen die neuen Mittel gefährlich sein? Helfen sie nicht zumindest Italien und den anderen besonders von Corona betroffenen Ländern?
Jein. Alle Mitgliedsstaaten erhalten Teile der Beihilfen, Italien etwa 80 und Spanien etwa 70 Milliarden Euro.
Der Haken: Im Gegenzug müssen die Staaten Bedingungen erfüllen, die die EU-Kommission festlegt. Welche das sein werden, ist offen. Aber: Der zentrale Mechanismus ist das sogenannte „Europäische Semester“. Dieses Regelwerk stammt aus der Eurokrise und funktioniert so: Die EU-Kommission gibt den Ländern jährlich Empfehlungen zur Wirtschaftspolitik – offiziell unverbindlich. Nun werden diese Empfehlungen verpflichtend. Wer Corona-Gelder will, muss sie umsetzen.
Was ist das Problem damit, die EU-Hilfen an Bedingungen zu knüpfen?
Die Geschichte zeigt, dass die Empfehlungen der EU-Kommission eine klar neoliberale Schlagseite haben. Zwischen 2011 und 2018 „empfahl“ sie Staaten 105-mal Pensionskürzungen und 50-mal Maßnahmen gegen Lohnsteigerungen. Ganze 63-mal forderte die Kommission sogar Kürzungen und Privatisierungen im Gesundheitssystem. Die EU-Corona-Hilfen werden nun also an ein Instrument gebunden, das in der Vergangenheit die Gesundheitsversorgung in Europa gefährdet hat.
Viele argumentieren jetzt: Es könnte diesmal anders kommen. Vielleicht hat die EU-Kommission ja dazugelernt! Doch dafür gibt es wenig Anhaltspunkte, während die Erfahrungen der jüngeren Geschichte ein klares und düsteres Bild zeichnen. Hinzu kommt: Es ist grundsätzlich undemokratisch, dass die EU-Kommission als ungewählte Exekutive alleine entscheiden darf, wer zu welchen Bedingungen Geld bekommt – und wer nicht.
Ist der Aufbaufonds nicht trotzdem ein Zeichen europäischer Solidarität?
Nein, er könnte sogar zu noch stärkerem Wettbewerbs-Nationalismus führen. Denn jeder Staat erhält das Recht anzuzweifeln, ob die anderen Staaten ihre Bedingungen brav einhalten – und kann eine Debatte darüber im Rat erzwingen. Damit können Regierungen Beihilfen verzögern, Druck für undemokratische Politik aufbauen und sich mit nationalistischer Rhetorik gegenüber anderen Staaten profilieren. Sebastian Kurz hat das mit dem Sager von „Staaten, die in ihren Systemen kaputt sind“ bereits eindrucksvoll zur Schau gestellt.
Aber hat Kurz nicht geringere Beitragszahlungen für Österreich erreicht?
Jein. Österreich wird zukünftig sogar mehr an die EU zahlen als bisher, nämlich 5,4 statt 2,9 Milliarden Euro im Jahr. Grund dafür ist der Brexit. Die fehlenden Beiträge Großbritanniens werden auf die anderen Länder aufgeteilt. Nettozahler wie Österreich haben bereits länger einen Rabatt für sieben Jahre zugesagt bekommen. Dieser wurde jetzt, wie teilweise schon erwartet, noch mal erhöht.
Was Kurz „erreicht“ hat, ist den Anteil der Beihilfen am Gesamtpaket zu senken. Damit bekommt aber auch Österreich weniger Geld. Zieht man diesen Verlust ab, wird Österreich in den kommenden Jahren sogar schlechter aussteigen als ursprünglich schon zugesagt war. Außerdem, und das ist für alle Beteiligten ganz angenehm, überdeckt jetzt das ganze Gerede über Rabatte die eigentlichen Probleme des Deals.
Heißt das, Merkel und Macron sind die Guten?
Manche Medien und Kommentator*innen meinen jetzt: Kurz und Co. waren geizig und unsolidarisch, Merkel hingegen proeuropäisch und großzügig. Das ist falsch und übersieht drei Dinge:
Erstens waren Merkel und Macron von Anfang an dafür, nur jenen Staaten zu helfen, die die neoliberal geprägten Bedingungen der EU-Kommission umsetzen. Das Aufbaupaket droht so zu einem weiteren Mittel zu werden, um Druck für Privatisierungen und Sozialabbau zu machen. Die EU dient schon seit Jahren dazu, die Machtverhältnisse in den Staaten Richtung Kapital und gegen Gewerkschaften und soziale Bewegungen zu verschieben.
Zweitens brechen die neuen Maßnahmen nicht mit der neoliberalen Grundausrichtung der EU, sondern passen sie nur der Krise an. Dass es jetzt gemeinsame Schulden gibt, ist historisch nichts Neues und bedeutet an sich noch nicht Solidarität. Zwar soll es nun höhere Transferzahlungen zwischen den Staaten geben, sie sollen jedoch keinesfalls auf Dauer gestellt werden. Einen wirklichen Bruch würde es erst bedeuten, wenn die Staatsschulden der Mitgliedstaaten den Finanzmärkten entzogen würden. Doch Grundpfeiler der EU wie der Standortwettbewerb, der seit Jahrzehnten zu einer Abwärtsspirale bei Löhnen, Sozial- und Umweltstandards sowie Steuern auf Unternehmensprofite und Vermögen führt, bleiben uneingeschränkt bestehen.
Und drittens enthalten die Beschlüsse des EU-Gipfels auch in anderen Politikbereichen vieles, was progressive Kräfte ablehnen müssen. So sieht das neue Budget viel Geld für die Militarisierung nach außen und innen vor: 23 Milliarden mehr für die tödliche Abschottung der Außengrenzen und 20 Milliarden mehr für neue Waffensysteme und „Sicherheit“.
Warum war Sebastian Kurz dann dagegen? Eine EU des Neoliberalismus und der Abschottung dürfte ihn ja kaum stören.
Sebastian Kurz geht es weniger um Inhalte als um seine Show. Er spielt den starken Mann gegen Beihilfen für Südeuropa, um bei FPÖ-Wähler*innen zu punkten. Aber er wusste, dass sich schlussendlich ohnehin Merkel, Macron und die EU-Kommission durchsetzen würden. Er riskierte also wenig.
Zugleich war Kurz’ Auftreten für seine vermeintlichen Gegenspieler*innen sogar nützlich: Ohne die „geizigen Vier“ hätte der zentrale Konflikt des EU-Gipfels gelautet, ob die Staaten überhaupt Bedingungen für die Corona-Mittel erfüllen müssen. Jetzt müssen die südeuropäischen Länder diese zähneknirschend hinnehmen – und froh sein, dass es überhaupt Beihilfen gibt. Vor allem die EU-Kommission hat bekommen, was sie wollte: noch mehr Macht über die Wirtschaftspolitik in den EU-Staaten.
Aber wenn Kurz nationalistisch agiert, müssen wir uns dann nicht auf die Seite von Merkel und Macron schlagen?
Nein. Und doch tun es fast alle. Schuld daran ist die Art, wie Diskurse über die EU funktionieren. Meist gibt es nur zwei Pole: proeuropäisch vs. nationalistisch. Doch diese Unterscheidung greift zu kurz und blendet eigentliche politische Inhalte aus. Eine Wirtschaftspolitik, die Reichen und Konzernen nützt und der breiten Bevölkerung schadet, kann sowohl „proeuropäisch“ als auch „nationalistisch“ sein.
Eine echte linke Position muss beides kritisieren: den nationalistischen Diskurs von Kurz und Co. und die proeuropäische Inszenierung von Merkel und Macron. Denn beide Seiten stehen für die gleiche, zerstörerische EU-Politik des Standortwettbewerbs, der ausbeuterischen Handelspolitik und des tödlichen Grenzregimes. Um eine fundierte Kritik und wirksame politische Alternativen zu entwickeln, müssen wir uns von der Idee lösen, alles „Proeuropäische“ wäre gut.