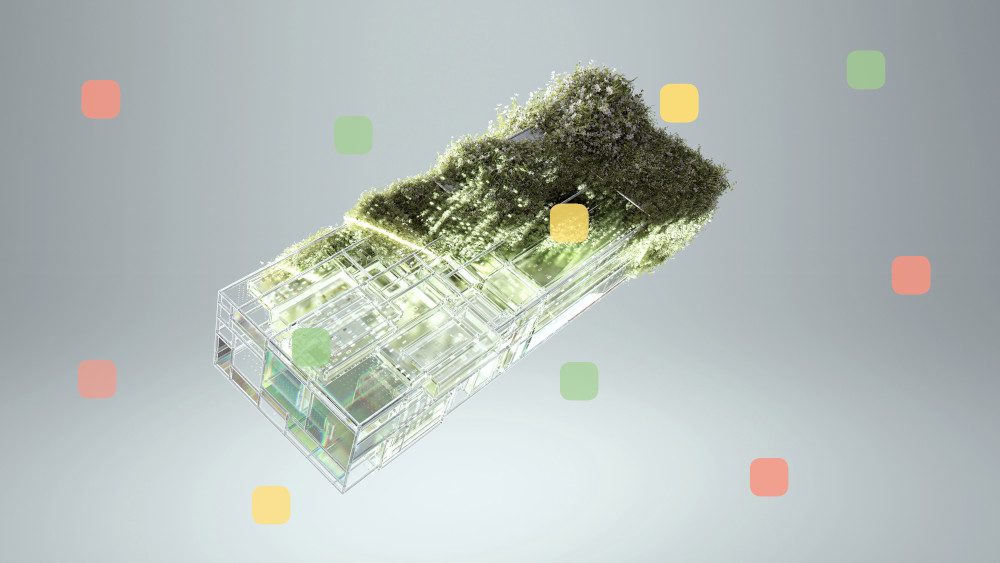Mosaik-Redakteurin Klaudia Rottenschlager traf die Künstlerin und Theoretikerin Belinda Kazeem-Kamiński im Rahmen der Verleihung des Cathrin Pichler Preises in Wien. Sie sprachen über Kontinuitäten der kolonialen Geschichte Österreichs.
Mosaik: Deine ausgezeichnete Videoarbeit The Letter dreht sich um die Erinnerung einer Gruppe von Westafrikaner_innen – 70 Männer, Frauen und Kinder – die 1896 nach Wien gebracht und hier zur Schau gestellt wurden. Wie hat sich die Recherchearbeit dazu gestaltet?
Belinda Kazeem-Kamiński: Das Thema beschäftigt mich schon seit 2005. Ich habe zum ersten Mal im Rahmen der Ausstellung Remapping Mozart: Hidden Histories davon gehört. Damals habe ich mir das Buch von Peter Altenberg angesehen, der seine persönlichen Erfahrungen während der Menschenschau in Wien publiziert hat. Das hat mich emotional stark betroffen, ich konnte aber mit meinen damals klassisch wissenschaftlichen Methoden der Repräsentationskritik, nicht weiter dazu arbeiten. Meine Emotionen fanden sich darin nicht wieder, das Thema war all die Jahre aber trotzdem immer präsent. Eigentlich habe ich jahrelang gebraucht, um einen Zugang zu finden, der nicht wieder über die Sicht eines weißen Typen läuft. Denn diesmal wollte ich mir Erinnerung und Archiv aus einer anderen Warte her ansehen.
Wie ist es dann zur Umsetzung gekommen?
2017 habe ich mich dann im Rahmen des Kültür Gemma! Stipendiums wieder mit den Materialien beschäftigt. In einem ersten Schritt habe ich Altenbergs Text, bearbeitet und exotisierende, rassistische und sexualisierende Stellen gelöscht. Übrig geblieben sind dann fast nur mehr Namen und Orte.
Bei weiteren Recherchen habe ich einen Brief einer der ausgestellten Frauen, Yaaborley Domeï, gefunden, der noch 1896 in Wien veröffentlicht wurde. Der Brief ist extrem stark und vom Inhalt her, könnte einiges auch heute geschrieben worden sein. Gleichzeitig hatte ich mit einer Übersetzung des Briefs aus ihrer Sprache Ga, ins Englische und dann ins Deutsche zu tun. Bei Übersetzungsprozessen kann natürlich viel verloren gehen, aber ihre Erfahrungen, Reaktionen und damaligen Wünsche sind klar kommuniziert. Ich dachte mir, was ist, wenn das nicht nur ein offener Brief an die Wiener Gesellschaft war, sondern auch an uns gerichtet ist, die Leute aus der afrikanischen Diaspora, die jetzt hier in Österreich leben?
Das war der Ausgangspunkt für das Video. Ich habe den Brief mit Unterstützung von Amoako Boafo, einem befreundeten Künstler, wieder bewusst in Ga zurückübersetzt. Ich habe mir die Frage gestellt, was es mit einem Archiv macht, wenn diese Sprache wieder dorthin getragen wird. Objekte in Archiven sind ja nicht tot. All diese Objekte haben Geschichten, also eigentlich müsste es in diesen Archiven immens laut sein, da gäbe es also noch viel zu erzählen.
Das Video spielt im Archiv des Weltmuseums. Man sieht dich und zwei Kolleg_innen mit schwarzen Handschuhen und Lupen bewaffnet, entschlossen ins Archiv schreiten. Warum hast du diesen gerade diesen Ort gewählt?
Mit dem Weltmuseum verbindet mich eine längere Geschichte. 2009 ist das Buch Unbehagen im Museum- Postkoloniale Museologien erschienen, das seinen Ausgang von der viel diskutierten Benin Ausstellung des Weltmuseums genommen hat. Damals habe ich begonnen mich mehr mit ethnologischen Museen, mit deren Geschichte und der Kritik daran auseinander zu setzen. Im Video geht es mir aber nicht explizit um das Weltmuseum, ich habe es eher als Ort genutzt, denn ich wollte in genau so einem Archiv drehen. Die Kuratorin Nadja Haumberger hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dort Objekte der Schaustellung von 1896 liegen. Da gibt es Schüsseln, Schuhe und Musikinstrumente. Ich wollte aber nicht mit diesen Objekten arbeiten, sondern mit dem Archiv und damit verbundenen Handlungen und Bewegungsabläufen, der Choreografie sozusagen. Wenn wir üblicherweise ins Archiv gehen, ziehen wir weiße Handschuhe an, arbeiten mit Lupen und Kameras etc., der Ort und die darin eingeschriebene Performance haben mich interessiert.
Du hast 2017 gemeinsam mit Nora Sternfeld und Natalie Baier auch den Sammelband Kuratieren als Antirassistische Praxis herausgegeben. Warum war der so wichtig?
Seit 2009 ist viel passiert in der Museumslandschaft und den Institutionen. Es wurde versucht sich mit der eigenen Geschichte auseinander zu setzen, Künstler_innen auch aus dem internationalen Raum wurden eingeladen sich daran zu beteiligen. Wir wollten mit dem Sammelband noch einmal die Frage aufwerfen, was es bedeuten kann, wenn wir nicht mehr von dem Standpunkt der Intervention ausgehen. Das Vokabular und die Kritik sind in der Mitte als Theorie angekommen. Aber welche Auswirkungen hat das auf die Praxis, vor allem die Praxis des Kuratierens?
Ich selbst habe in dieser Zeit begonnen an der Akademie der Bildenden Künste zu unterrichten und da sind bei mir weitere Fragen aufgekommen aufgetaucht, die praktischer waren. Wie ist die Institution auf mich vorbereitet? Die perfekte Institution gibt es nicht, das ist klar. Aber ich war damals zumindest meines Wissens nach die erste und einzige Schwarze Lehrende am Institut für künstlerisches Lehramt. Was bedeutet das dann für andere People of Color, die dort unterrichten oder nach mir unterrichten werden? Was kann ich schon ebnen, was lernt die Institution durch mich? Wie schauen die Verantwortlichkeiten aus, die mich angehen? Wie kann ich Kerben machen, dass es die die nach mir kommen, zumindest ein bisschen einfacher haben?
Es gibt in den letzten Jahren mehr Versuche diese ethnologischen Sammlungen auch in Österreich aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Dabei zeigt sich ein gewisses Bedürfnis, Vergangenheit abzuschließen. Denkst du, dass wir einen Schlussstrich unter diese kolonialen Geschichten ziehen sollen?
Die Idee Schlussstriche ziehen zu können und wollen, ist meist mit einem privilegierten Zugang verbunden. Von dieser Warte aus, ist es leicht sagen Wir sollten endlich einen Schlussstrich ziehen. Diese Themen gehen uns aber alle an. Es geht darum, dass diese Vergangenheit und die Erinnerung daran immer wieder von verschiedensten Generationen und verschiedensten Positionierungen heraus aktualisiert und mit der Gegenwart verbunden werden muss. Es ist ganz schlecht sich zu denken, dass wir von A bis Z Schritte durchführen, alles bereinigen können und dann ist das erledigt. Für mich ist das eine ganz schreckliche Vorstellung.
Wie ist es, in Österreich über Kolonialismus zu reden?
Wenn ich in solche Interviewsituationen komme, muss ich noch sehr oft darüber sprechen warum Österreich eine koloniale Geschichte hat. Ich höre immer wieder „Naja, aber Österreich hat jetzt wirklich nicht viel damit zu tun.“ Kolonialismus bedeutet für mich nicht nur gewaltsame Landnahme und Enteignung, es geht auch um eine gewisse Form der Wissensproduktion über das Andere. Wenn Menschen aber mit offenen Augen durch Wien gehen, ist die Geschichte sichtbei. Wenn sie Restaurants, Apotheken und öffentlichen Einrichtungen sehen, wenn sie die Straßennamen anschauen, dann kommen sie an dieser eingeschrieben kolonialen Geschichte nicht vorbei. Wir müssen viel weiter zurückgehen als die letzten zwanzig Jahre Migrationsgeschichte. Ich muss meine Arbeit immer noch rechtfertigen, dabei können wir durch das verstehen von Geschichte viel über die heutige politische Situation lernen.
Wie wichtig ist es Geschichten über koloniale Expansion, Genozid, den Holocaust und deren Kontinuitäten mit heutigen Formen von Rassismen in Österreich und dem erstarken rechter Kräfte, zusammen zu denken?
Es ist sehr wichtig und ich muss für mich selbst noch viel lernen. Ich habe mich intensiv mit Kolonialismus und Diskriminierung von Schwarzen Menschen auseinandergesetzt. Ich will im Zuge meiner Arbeit aber noch weiterdenken.
Der wissenschaftliche Markt ist ein kapitalistischer und darin gibt es auch verschiedene Hypes. Da ist mal Queer Theorie in, dann postkoloniale Theorie und dann wieder de-koloniale Theorie. Meist ist alles, zumindest in den Universitäten, jedoch ohnehin nur als Worthülse und nicht als Praxis da. Es ist wichtig, sich da nicht kaufen zu lassen und darüber hinaus nach diesen Kontinuitäten und Vernetzungen zu schauen. Gleichzeitig sollten wir keine Konkurrenzverhältnisse bedienen. Politisch ist es sehr wichtig, eine Sichtweise zu entwickeln, die gewaltvolle Geschichten miteinander denken lässt, jedoch nicht parallelisiert. Wir müssen eine Praxis entwickeln, die nicht wertet und danach fragt wer schlimmeres erlebt hat.
Filmtipp: The Letter (2018) von Belinda Kazeem-Kamiński.