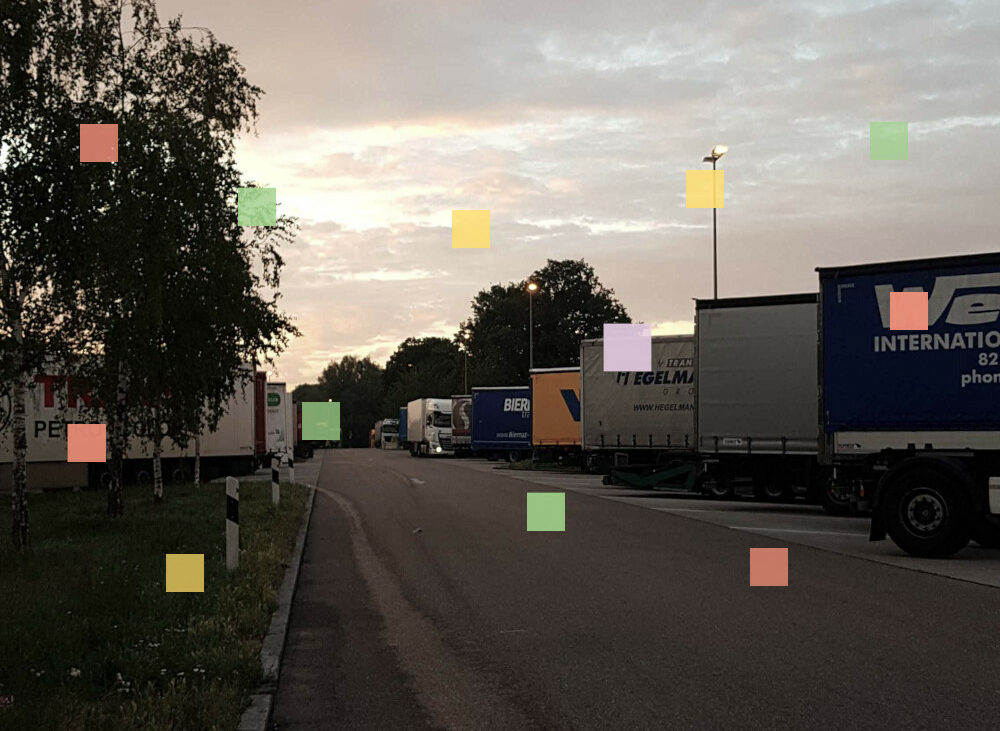Die Ausgangsbeschränkungen haben unseren Alltag komplett auf den Kopf gestellt und auch unser Sex- und Beziehungsleben verändert. Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller hat mit ihrer Studie „Liebe, Intimität und Sexualität in der Pandemie“ einiges an Medienrummel erzeugt. Sonja Luksik und Franziska Wallner haben sie zum Gespräch gebeten und ihrer Neugierde freien Lauf gelassen. Entstanden ist ein Interview über Sex, Dating, Selbstdisziplinierung, aber auch Solidarität.
In deiner Studie geben viele Paare an, dass es ihnen während der Ausgangsbeschränkungen gut gegangen ist. Ist unsere auf verbindliche Paarbeziehungen ausgelegte Gesellschaft besonders gut gegen Krisen gewappnet?
So einfach ist es nicht. Die entscheidende Rolle spielt die Qualität dieser Paarbeziehungen. Es ging vielen Zweier-Beziehungen sehr gut in der Pandemie, viele haben den „Lockdown“ sogar genossen. Aber eben nicht alle. Es kam auch zu Konflikten und Gewalt.
Die Krisenbearbeitung der Politik war auf ein neo-biedermeierliches Familienmodell ausgelegt. Nicht nur auf die Zweier-Beziehung, sondern auf die Zweier-Beziehung, die in einem Haushalt lebt. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn viele Paare wohnen in getrennten Haushalten.
Wie hat sich die Pandemie auf unser Sexleben ausgewirkt?
Stresssituationen verändern das sexuelle Begehren. Bei vielen sank die Lust, jede fünfte Person hatte aber mehr Lust auf Sex, sowohl mit einem/einer Partner*in als auch mit sich selbst. Einige haben sich angeregt gefühlt, neue Dinge auszuprobieren, etwa wie man körperliche Intimität digital vermittelt leben kann.
Viele Menschen mit Kindern im Haushalt waren sehr gestresst und hatten deshalb weniger Zeit für körperliche Intimität. Für Singles und Menschen mit unverbindlichen sexuellen Beziehungen war es ganz schwierig. Denn intime Kontakte zu knüpfen oder auch mit mehreren Leuten Sex zu haben war in der Pandemie nur schwer möglich.
Wie hat Dating stattgefunden?
Am Anfang haben die Medien behauptet, dass jetzt alle viel mehr online daten. Diese selektiven Ergebnisse kamen aber von Dating-Apps und stimmen so nicht.
Zu Beginn der Krise hat das gestimmt, weil viele noch schnell den/die „Corona-Partner*in“ finden wollten. Einige haben auch kurz vor Corona jemanden kennengelernt, mit dem sie es dann verbindlicher gestaltet haben oder zusammengezogen sind. Für die meisten hat das aber nicht so gut funktioniert. Sie haben ihr Dating eingestellt.
In deiner Studie geben erstaunlich viele Leute an, dass sie erleichtert sind, nicht dem ganzen Stress rund um Sex, Intimität und Beziehungen ausgesetzt zu sein. Ist das nicht bezeichnend dafür, dass etwas in unserer Gesellschaft falsch läuft?
Ja! Und dass die Leute auch so viel Alltagsstress haben, dass sie erleichtert sind, wenn der wegfällt. Also Freizeitstress und private Treffen, zu denen man eh nicht gehen will.
Wie hat denn Corona unsere sozialen Beziehungen verändert?
Viele haben beschrieben, dass sie ein ganz anderes Empfinden von Nähe und Distanz entwickelt haben. Also wenn sie Filme schauen, dann haben sie zum Beispiel den Eindruck, dass sich die Schauspieler*innen viel zu nahekommen. Die Teilnehmer*innen meiner Studie haben also sehr schnell verinnerlicht, dass Nähe gefährlich ist. Das bleibt jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang so.
Dabei sind körperliche Nähe und Berührungen sehr wichtig. Diese Nähe haben viele Leute sehr schmerzhaft vermisst, Singles und Alleinlebende natürlich ganz besonders.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen braucht es, damit Alleinlebende und Singles in solchen Krisen besser aufgefangen werden?
Man könnte zum Beispiel allen Leuten nahelegen, ihre Kontakte auf eine kleine Gruppe an Personen einzuschränken, unabhängig vom Haushalt. So quasi: Jede*r kann privat fünf Leute treffen oder sonst irgendwie „Corona-Bezugsgruppen“ bilden, die aufeinander schauen.
Für viele war die Aufforderung, gar keine Menschen mehr zu treffen außer Haushaltsmitglieder eine Zumutung. Was ist, wenn ich keine Haushaltsmitglieder habe? Was ist, wenn meine Haushaltsmitglieder psychische Gewalt ausüben? Das war bei jede*r zehnten befragten Person der Fall.
Für manche war es sehr einfach, sich an die Regeln zu halten, während es für andere massive soziale Isolation bedeutet hat. Insbesondere junge Menschen waren sehr stark belastet, besorgt und einsam. Sie fanden ihr Sozialleben trostlos und hatten Angst, dass ihre intimen Beziehungen und der Alltag auseinanderbrechen. Das muss man ernst nehmen.
Daher sollte man gesellschaftlich abwägen, wie sehr man bei bestimmten Maßnahmen Druck macht. Teilweise wird da auch zynisch argumentiert: Die Leute müssen Angst haben, damit sie die Maßnahmen befolgen. In meiner Studie sehe ich, dass fast alle die Maßnahmen sehr streng befolgt haben. Aber manche Menschen hat das massiv verunsichert. Kontakte zu reduzieren und wochenlange Selbstisolation, das sind einfach zwei Paar Schuhe.
Welche Rolle haben Unterstützungsnetzwerke gespielt?
Die Leute waren sehr solidarisch. Zum Beispiel bei queeren Communities konnte man sehen, dass die aus sehr tragfähigen Beziehungen bestehen, die auch in Krisenzeiten stützen. Viele haben Veranstaltungen und Treffen in den virtuellen Raum verlagert. Es gab sozusagen eine kollektive Bewältigungsstrategie.
Von vielen wurde aber auch ganz praktische Nachbarschaftshilfe geleistet. Ich war überrascht, dass so viele Menschen neue Leute kennengelernt haben, wodurch sich das Unterstützungsnetzwerk auf einmal erweitert hat. Das ist sehr eindrucksvoll.
Parallel dazu hat die Krise eine Menge Nachteile gebracht und viele Bevölkerungsgruppen wurden in der Krise vergessen. Das darf man nicht ausblenden.
Angenommen, es kommt wieder zu einem Lockdown: Wie könnte man soziale Isolation abfedern?
Ich finde, man sollte weniger moralisch appellieren, dass die Menschen individuell die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Stattdessen sollte man für die sozialen Bedingungen sorgen, damit alle gut durch die Zeit der Kontaktbeschränkung kommen.
Was sind eigentlich die psychischen und sozialen Voraussetzungen, damit man das aushält? Es soll verhältnismäßig bleiben und man kann nicht erwarten, dass Menschen wochenlang niemanden treffen. Da hat man sich nur um die körperliche Gesundheit gekümmert und vergessen, dass auch die Psyche mit dem Körper zusammenhängt. Das hat massive psychosoziale Folgen, für die man soziale Verantwortung übernehmen muss, im persönlichen Bekanntenkreis und auch als Gesellschaft. Für manche Menschen sind solche Situationen sehr belastend und bedeuten starke Lebensumstellungen. Auch den Verlust von Sozialkontakten, von Sexkontakten, der liebsten Freizeitaktivitäten, vielleicht auch von Lebensplänen, das sollte man nicht bagatellisieren.
Die realistischere Frage ist also: Wie kann man sein Leben lustvoll und risikoarm leben? Risikoarm bedeutet etwas anderes als niemanden mehr zu treffen. Gerade Leuten, die alleine leben, muss man das zugestehen – und sich ihnen vielleicht auch als Bezugsperson im nächsten Lockdown anbieten.