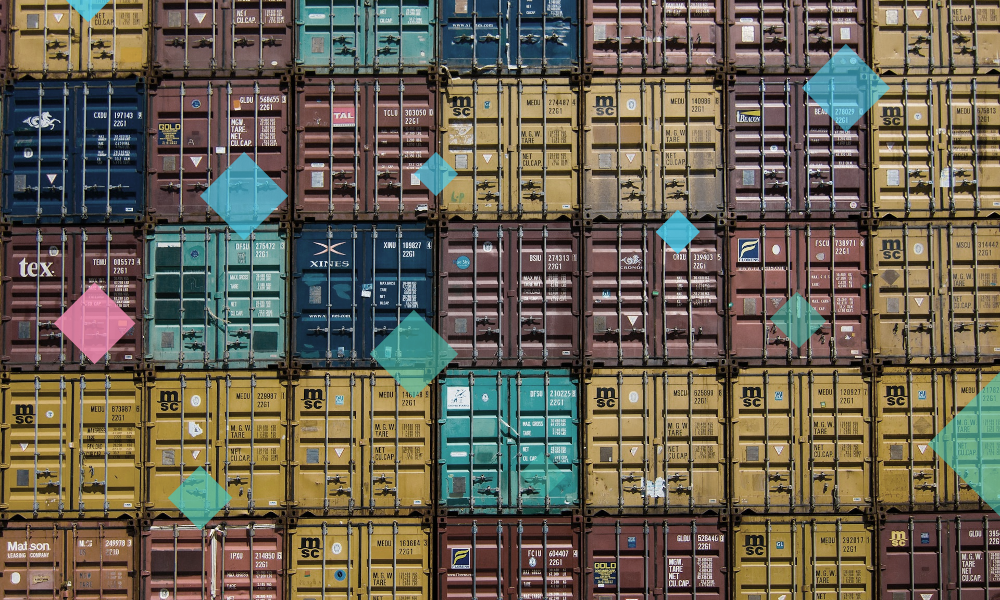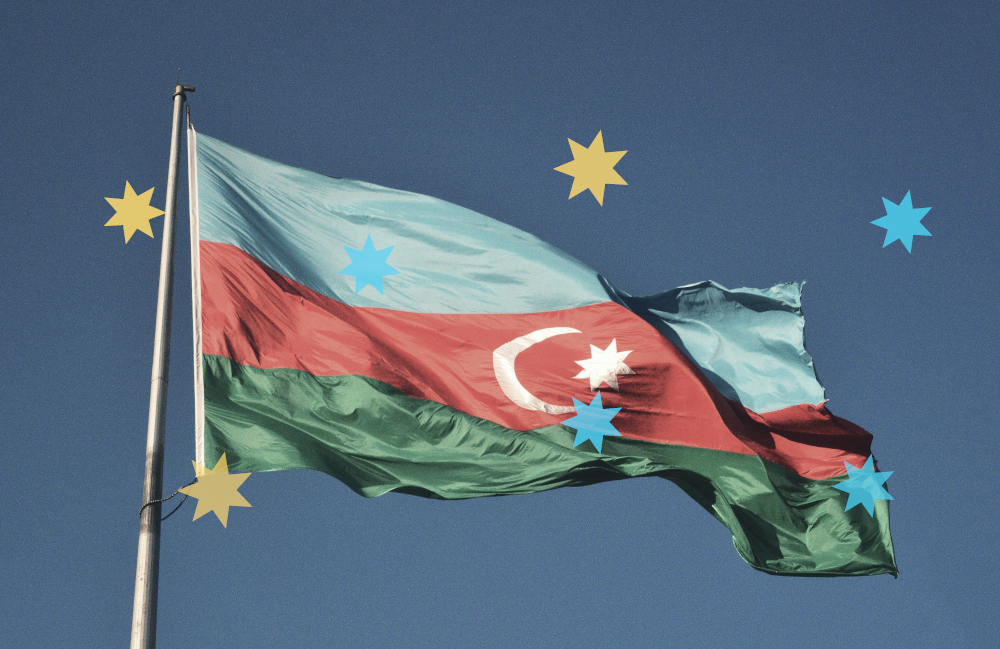Ausgerechnet in ländlichen, traditionell tief konservativ geprägten Teilen der USA erschüttern wilde Streiks die politische Odnung. Beginnt die Erneuerung der amerikanischen Linken in Gegenden, die von den Demokraten längst abgeschrieben wurden? Ein Bericht von Adam Baltner.
Die aktuelle Streikbewegung fing in West Virginia an. Der Bundesstaat gilt seit mehr als einem Jahrhundert als einer der ärmsten und am wenigsten entwickelten der USA. Das liegt teils an der isolierten Berglandschaft, vor allem aber an der anhaltenden Abhängigkeit vom Kohlenbergbau. Donald Trump gewann hier mit 69 Prozent der Stimmen, kein Kandidat hatte im Bundesstaat jemals besser abgeschnitten.
In den letzten 50 Jahren ist die Armut in West Virginia immer stärker gewachsen, während die Kohlenindustrie immer weiter schrumpfte. Gleichzeitig kürzte die Politik im Sozial- und Bildungsbereich. Viele LehrerInnen und SozialarbeiterInnen müssen nebenher in Supermärkten oder Fast-Food-Restaurants arbeiten, um über die Runde zu kommen.
Auslöser: Überwachungs-App
In dieser Situation wollte der Bundesstaat West Virginia die monatlichen Beiträge für die Krankenkassen dramatisch erhöhen. Dazu sollte ein „Wellness-Programm“ eingeführt werden, das alle öffentlich Bediensteten dazu verpflichtet, eine Schrittzähler-App zu nutzen. Je höher der tägliche Durchschnitt an Schritten, desto mehr „Punkte“. Wenn man zu wenig Punkte in einem Jahr gesammelt hätte, wäre eine 500-Dollar Geldstrafe zu bezahlen gewesen.
Als die Pläne in November 2017 bekannt gegeben wurden, begannen sich die LehrerInnen der Gewerkschaftsbasis zu organisieren. Sie hielten Treffen mit KollegInnen ab, organisierten Lesekreise, machten Öffentlichkeitsarbeit in ihren Communities und gründeten eine Facebook-Gruppe. Als die Gruppe sich in „West Virginia Public Employees United” („West Virginia öffentliche Bedienstete vereinigt“) umbenannte und damit ihre Ausrichtung verbreitetet, stieg die Mitgliederzahl auf über 20.000. Mitte Jänner organisierten AktivistInnen regelmäßige Demonstrationen vor dem Parlament in der Hauptstadt Charleston. Anfang Februar kam es zu ersten Arbeitsniederlegungen – ohne offiziellen Beschluss der Gewerkschaftsführung. Ein sogenannter wilder Streik nahm seinen Lauf.
Gewerkschaftsführung muss dem Druck der Basis nachgeben
Letztendlich musste die LehrerInnengewerkschaft ihrer Basis folgen. Sie rief einen zweitägigen Streik in allen Schulbezirken aus. Um diesen zu verhindern, nahm die staatliche Versicherungsanstalt die angekündigten Änderungen bei der Krankenversicherung zurück. Das Parlament erklärte sich bereit, LehrerInnengehälter um zwei Prozent. zu erhöhen. Mit diesem Angebot gaben sich die LehrerInnen aber nicht zufrieden und lehnten einen Kompromiss im Vorfeld des Streiks ab. Der Streik wurde sogar ausgeweitet.
Am 27. Februar trafen die Gewerkschaftsführung und der Gouverneur eine neue Vereinbarung. LehrerInnengehälter sollten um bis zu fünf Prozent angehoben werden, die Gehälter anderer öffentlichen Bedienstete um bis zu drei Prozent. Die Basis lehnte auch diesen Deal erneut ab.
Der Streik hielt noch eine weitere Woche an. Das Parlament verabschiedete schließlich eine Gehaltserhöhung um fünf Prozent für alle öffentlich Bediensteten. Zusätzlich dazu soll es eine Lösung für die hohen Versicherungskosten geben. In den nächsten Monaten stehen dazu weitere Möglichkeiten für Mobilisierungen an.
Eine Welle bricht los
Der Soziologe Eric Blanc bezeichnete das Ergebnis in West Virginia als „den wichtigsten Sieg der amerikanischen Arbeiterbewegung seit mindestens den 1970er-Jahren“. Diese Einschätzung wird unter anderem dadurch bestätigt, dass LehrerInnen in anderen Bundesstaaten den Streik der KollegInnen in West Virginia nachahmten.
Zunächst in Oklahoma. Dort verdienen LehrerInnen sogar noch weniger, ihre Gehälter sind die niedrigsten in den gesamten USA. Weil Ausgaben pro SchülerIn seit der Finanzkrise 2008 um 28 Prozent gekürzt wurden, musste ein Fünftel der Schulbezirke eine Vier-Tage-Woche einführen.
Kurz darauf fand in Arizona der nächste mehrtägige LehrerInnenstreik statt – es war der bisher größte. Im Gegensatz zu West Virginia und Oklahoma hatte Arizona bis 2008 eines der besten Bildungssysteme der USA. Innerhalb von zehn Jahren verkam es durch die Kürzungspolitik allerdings zu einem der schlechtesten.
Nach Abzug der Inflation sind aktuelle LehrerInnengehälter in Arizona um 10 Prozent niedriger als 2010. Mittlerweile gibt es 2.000 Lehrstellen, die unbesetzt sind. 3.400 weitere Posten werden von unterqualifizierten Personen besetzt. Insgesamt sind die staatlichen Jahresausgaben für Bildung seit der Finanzkrise alleine in Arizona um 1,1 Milliarden Dollar geschrumpft.
Schockstrategie der Eliten
Dass nach der Finanzkrise besonders im Bildungsbereich dramatisch gekürzt wurde, ist kein Zufall. Die Krise wurde gezielt benutzt. Die eingesetzte Schock-Strategie diente dazu, das US-Bildungswesen zu privatisieren. Dahinter stehen Milliardäre wie die erzkonservativen Brüder Charles und David Koch und Donald Trumps Bildungsministerin Betsy DeVos.
Derzeit besuchen 17 Prozent der SchülerInnen etwa in Arizona sogenannte „Charter Schools“, Privatschulen außerhalb des öffentlichen Systems. Anders als öffentliche Schulen, die von gewählten SchulrätInnen verwaltet werden, werden „Charters“ wie private Firmen geführt. Viele verlangen Gebühren, manche sind sogar gewinnorientiert. In der Regel verbieten sie ihren MitarbeiterInnen, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden.
Was für viele EuropäerInnen befremdlich klingen mag: Auch viele Linksliberale unterstützten in den USA noch bis vor wenigen Jahren die „Charters“. Probleme im Bildungsbereich wurden „faulen LehrerInnen“ und ihren Gewerkschaften angelastet, Charter Schools als Lösung angepriesen. Vor Donald Trump war die Verbreitung von Charters eine Schlüsselpriorität der Bildungspolitik Barack Obamas.
Ein Hoffnungsschimmer
Die erfolgreichen LehrerInnenstreiks könnten eine echte Trendwende einleiten. Zunächst, weil die Streiks die Arbeitsbedingungen für LehrerInnen und SchülerInnen massiv verbessert haben. Darüber hinaus zeigen sie neue Wege für die Zukunft auf. Erstens widerlegen sie die liberale These, dass bestimmte Regionen hoffnungslos reaktionär sind, weil die BewohnerInnen dort in den letzten Jahren mehrheitlich rechts gewählt haben. Zweitens zeigen sie, wie ArbeiterInnen sich erfolgreich organisieren können, obwohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies in den letzten Jahren immer schwieriger gemacht haben
Eines der positivsten Ergebnisse der bisherigen Streikwelle ist die Politisierung von vielen Menschen um Fragen von Klasse und sozialer Gerechtigkeit. Sei es unter LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, öffentlich Bediensteten oder SympathisantInnen. Viele Menschen, die bei den Streiks aktiv geworden sind, sind jetzt in Gewerkschaften oder anderen politischen Netzwerken organisiert. Vor allem auch an ihren Arbeitsorten. Das ist im US-Kontext umso wichtiger, wo Gewerkschaften seit Jahrzehnten in die Defensive geraten sind.
In West Virginia haben Gewerkschaften nicht einmal das Recht, Streiks auszurufen. Das hält sie aber nicht davon ab, es trotzdem zu machen. Dass der Streik in West Virginia „gesetzwidrig“ war, war im Endeffekt egal. Die Organisierung und Solidarität der Streikenden hat den Bundesstaat dazu gezwungen, den Forderungen nachzukommen. Frei nach dem Slogan der amerikanischer ArbeiterInnenbewegung aus der 1960er- und 70er-Jahren: „Es gibt keine illegalen Streiks, sondern nur erfolglose Streiks.“
Adam Baltner ist Lehrer und organisiert die Jacobin Reading Group in Wien.