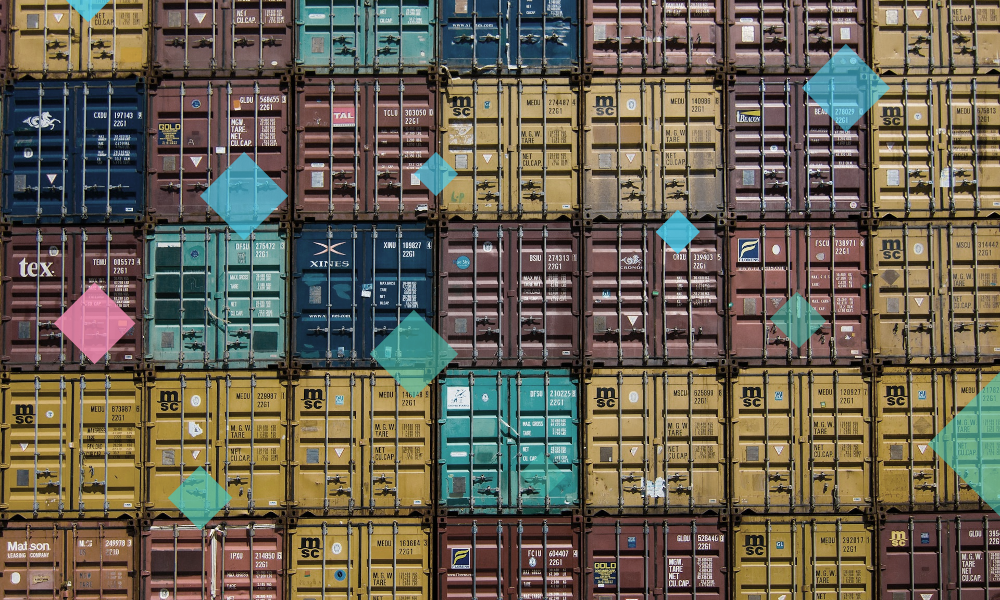Seit Jahren wird in Deutschland von einer Krise in Krankenhäusern und Kitas (Kindertagesstätten, öst.: Ganztageskindergärten) gesprochen. Aber sind das wirklich die gleichen Kämpfe? Und wenn nicht, wie bringen wir sie zusammen? Ein Denkanstoß von Julia Dück.
Krankenschwestern streiken nicht? Und Erzieher*innen spielen nur mit den Kindern? Von wegen! Immer wieder kommt es zu Streiks in Krankenhäusern und Kitas. So etwa im Sommer 2021 in den Kliniken in Berlin oder aktuell im deutschen Sozial- und Erziehungsdienst. Gewerkschaften erkennen den Bereich bezahlter Sorgearbeit zunehmend als Speerspitze tariflicher Auseinandersetzungen. Denn Beschäftigte beklagen schon lange Personalmangel, Zeitdruck und Arbeitsverdichtungen. Und damit auch, dass sie ihre beruflichen Ansprüche nicht (mehr) umsetzen können.
So kritisieren Pflegekräfte bundesweit die Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf das sogenannte Fallpauschalen- oder DRG-System (Diagnosis Related Groups) und seine Folgen – nämlich Personalabbau, Kostendruck oder Outsourcing von Bereichen. Aber auch die Abspaltung fürsorglicher Tätigkeiten aus der Pflege. Auch in den Kitas werden immer wieder massive Arbeitsverdichtungen und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen beklagt. Wie auch, dass Bildung in den Kitas so nicht umsetzbar ist. Dass wir im Feld der bezahlten Sorgearbeit daher zunehmend Streiks und gewerkschaftliche Kämpfe beobachten können, ist kein Zufall. In den Krankenhäusern streiten die Beschäftigten für Entlastung (und die tarifliche Wiedereingliederung outgesourcter Bereiche) und in den Kitas für eine Aufwertung des Berufs.
Kein Geld, keine Zeit, keine Sorge
Was aber sind die Anliegen von Pflegenden und Erzieher*innen? Und führen sie wirklich dieselben Kämpfe? In den feministischen Krisendiskussionen wird seit Langem von einer Krise der sozialen Reproduktion, einer Care- oder Sorgekrise gesprochen. Gemeint sind krisenhafte Veränderungen in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ebenso wie in den privat geleisteten Sorgeverantwortungen, aber auch transnationale und globale Verschiebungen von Care. Also etwa, Erschöpfungen in den Privathaushalten, ein Verlust an Qualität in der bezahlten Sorge oder Versorgungslücken, die durch die deutsche Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland in den Entsendeländern entstehen.
Alles dieselbe Krise?
Theoretisch begründet wird „die Krise“ in feministischen Krisendebatten mit einer strukturellen Abwertung von Sorge im Kapitalismus. Also damit, dass Care nach Marktkriterien reorganisiert und rationalisiert, der Abschöpfung von Profit untergeordnet, möglichst kostengünstig zur Verfügung gestellt und nicht mehr ihren Besonderheiten entsprechend umgesetzt wird. Die Situation in Krankenhäusern und Kitas scheint sich jedoch sehr zu unterscheiden. So sehen wir einen marktwirtschaftlichen Umbau und betriebswirtschaftlich motivierte Einsparungen samt Personalabbau, Reduktion von Bettenkapazitäten und Verweildauern von Patient*innen in den Krankenhäusern. In den Kitas gibt es hingegen einen umfassenden Ausbau von Betreuungskapazitäten und eine Vervielfachung des Finanzierungs- und Stellenvolumens.
Wieso also sprechen wir von einer strukturellen Abwertung der Sorge? Trifft das auf alle Bereiche zu? Und: Wenn sich in Krankenhäusern und Kitas unterschiedliche Entwicklungen vollziehen, wieso beklagen Beschäftigte in beiden Bereichen eine Verschlechterung der Arbeits- und Versorgungsbedingungen – also ähnlich klingende Krisen?
Krisen der Erschöpfung, der Versorgung und der Gewohnheiten
Aus meiner Sicht müssen wir analytisch verschiedene Dimensionen (einer Krise) der sozialen Reproduktion unterscheiden. Soziale Reproduktion meint demnach nicht nur die Regeneration von Menschen, also dass sie erholt, gesund, gekleidet oder genährt sind. Sie meint auch nicht nur die generationale Reproduktion, also dass sie sich um Kinder, Kranke oder Alte kümmern. Vielmehr meint der Begriff drittens auch die subjektivierende Reproduktion, also dass Menschen in ihren Gewohnheiten, Vorlieben oder ihren Vorstellungen und Bedürfnissen geprägt werden. Für den Krisenbegriff bedeutet dies, dass Krisen sich nicht reduzieren lassen auf die Knappheit von Ressourcen, Versorgungslücken oder Erschöpfung. Sie umfassen ebenso das Denken, Fühlen und Handeln der vergeschlechtlichten Subjekte. Krisen der Gewohnheiten entstehen dabei, wenn Menschen ihre Lebensweisen und Gewohnheiten ändern müssen oder wollen. Was meint dies?
Wenn Arbeitsbedingungen und Lebensweisen nicht mehr zueinander passen
Die Art und Weise, wie produziert, gearbeitet und konsumiert wird, ist auf Subjekte angewiesen, die bereit sind, entsprechend zu arbeiten, zu leben und Bedürfnisse zu befriedigen. Passen Lebensweisen und vergeschlechtlichte Subjektivitäten hingegen nicht zu den Anforderungen der Arbeit, kann es zu Krisen kommen. Entweder weil eine bestimmte Produktionsweise nicht umsetzbar ist oder weil Menschen zu Veränderungen ihrer Gewohnheiten, alltäglichen Praxen und Ansprüche gezwungen sind. Genau das vollzieht sich aktuell in Krankenhäusern und Kitas: Hier finden unterschiedliche Veränderungen statt – nämlich eine Abwertung der Sorgearbeit in den Krankenhäusern, aber eine finanzielle und ideologische Aufwertung der pädagogischen Arbeit als Bildungsarbeit in den Kitas. Dennoch gibt es damit in beiden Bereiche einen umfassenden Wandel der ökonomisch-materiellen (Rahmen-)Bedingungen der Arbeit sowie der politisch-ideologischen Regulierungen und des beruflichen Verständnisses von Sorge. Dies zieht nach sich, dass sich die Anforderungen an Pflegende und Erzieher*innen verändern.
Sorge-Kämpfe neu in den Blick genommen
Krisen der Sorge oder sozialen Reproduktion entstehen gegenwärtig also aus einem Zusammenspiel von einer Abwertung von Sorge (wie in Krankenhäusern) oder ihrer Nutzbarmachung (wie in Kitas) und dem gleichzeitigen Druck auf die Handlungsweisen und beruflichen Ansprüche der Beschäftigten.
Krisen der sozialen Reproduktion auch als Krisen der Gewohnheiten zu verstehen, hilft dabei, Krisen nicht objektivistisch misszuverstehen – nämlich als Erschöpfung endlicher menschlicher Ressourcen oder als Entstehen von Mangel bei gegeben Bedürfnissen. Vielmehr zeigt es auf, dass die Menschen, ihr Krisenhandeln und ihr Krisenbewusstsein nicht voneinander zu trennen sind. Denn sie können sich den Veränderungen anpassen, neue Anforderungen, Routinen oder Bedürfnisse übernehmen. Sie können sich aber auch verweigern, ihre alten Handlungsweisen verteidigen, sich gegen den Wandel zur Wehr setzen oder Arbeitsverhältnisse verlassen. Beides kann zu einer Bearbeitung von Krisen führen oder diese verschärfen. In jedem Fall ist es nicht lediglich objektiv feststellbar, sondern hängt davon ab, wie die Menschen in Krisen handeln und was sie als Krisen erfahren, und ob sie zum Handeln und eine Veränderung ihrer Bedürfnisse gezwungen werden. Krisen der Sorge sind folglich mehr als Erschöpfungen im Hamsterrad.
Um aktuelle Kämpfe um Sorge zu verstehen, müssen wir also auch die Perspektive der Sorgearbeitenden berücksichtigen. Denn Pflegende und Erziehende sind nicht nur Objekte der Anschauung, sondern Subjekte in den Veränderungen. Ihre Motivationen zu verstehen, ist daher der Ausgangspunkt für gemeinsame Kämpfe.