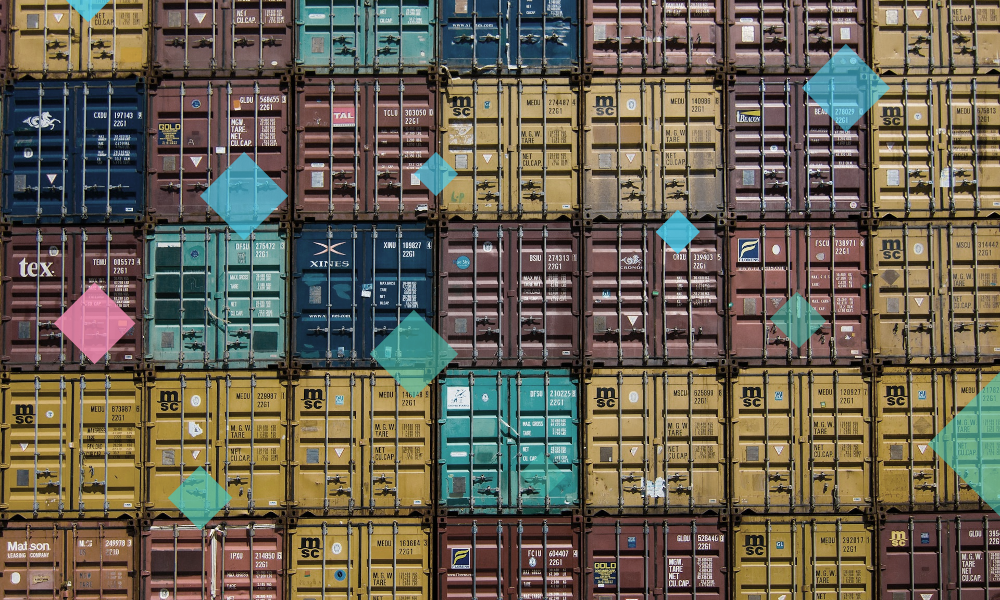Im Interview mit mosaik-RedakteurInnen Sophie Gleitsmann und Fabian Hattendorf erzählt die Ökonomin Corinna Dengler vom Ökofeminismus in Theorie und Praxis, wie er mit ökonomischen Konzepten zusammenhängt und warum es sich schon heute lohnt, gegen das Patriarchat zu kämpfen.
mosaik: Oft heißt es, dass Wissenschaftler*innen objektiv sein müssen, um ernst genommen zu werden. Deshalb sollten sie sich klar vom Aktivismus distanzieren. Du bezeichnest dich selbst als Wissenschaftlerin und Aktivistin – wie passt beides für dich zusammen?
Corinna Dengler: Dieser Dualismus ist künstlich konstruiert und muss kritisch hinterfragt werden. Ich verorte mich in der feministischen Wissenschaftstheorie, die zunächst einmal anerkennt, dass jede*r Wissenschaftler*in prä-analytische Vorannahmen hat. Wir können uns entscheiden, diese eigenen normativen Grundannahmen hinter dem Deckmantel der Objektivität zu verstecken. Oder wir können sie explizit machen.
Insofern sehe ich es für mich als sehr wichtig an, genau diese vermeintliche Wertneutralität, diesen Glauben, dass wir outside the box auf die Gesellschaft schauen können, zu kritisieren. Dazu gehört auch, über die künstliche Trennung von Wissenschaft und Aktivismus nachzudenken.
Ich denke, dass es gerade in Forschungsfeldern wie Klimagerechtigkeit oder Postwachstum wichtig ist, einen normativen Standpunkt zu haben und nicht nur im Elfenbeinturm dazu zu forschen. Deshalb erwarte ich eigentlich von Wissenschaftler*innen in diesem Feld, die eigene Theorie zur Praxis zu machen. Oder ich empfinde es zumindest nicht als ‚unwissenschaftlich‘, wenn Menschen das versuchen.
Du forschst zu ökofeministischer Theorie. Sie geht davon aus, dass die Unterdrückung der Frau und der Natur nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Was bedeutet das?
Ökofeminismus ist aus sozialen Bewegungen heraus in den späten 1960er Jahren entstanden. Er hat erstmals die strukturelle Ähnlichkeit zwischen der Ausbeutung der Natur und der unbezahlten Reproduktionsarbeit von Frauen, die genauso unsichtbar gemacht wird, aufgezeigt. Dabei wurde klar, wie diese verschiedenen Unterdrückungssysteme zusammenhängen, dass sie sich gegenseitig bedingen und sich nicht in Haupt- und Nebenwidersprüche einteilen lassen.
Was ist mit Haupt- und Nebenwidersprüchen gemeint?
Orthodoxe Marxist*innen gehen davon aus, dass es einen im Kapitalismus begründeten Hauptwiderspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat gibt. Die Logik dahinter ist, dass sobald sich dieser Hauptwiderspruch auflöst, sich Nebenwidersprüche wie zum Beispiel das Patriarchat oder Rassismus ebenfalls auflösen. Feminist*innen und Menschen aus der antikolonialen Bewegung haben gezeigt, dass das eben nicht so ist.
Audre Lorde hat zum Beispiel gesagt: „There is no hierarchy of oppressions“. Das bedeutet, anzuerkennen, dass es zwar verschiedene Unterdrückungsmechanismen gibt, diese aber spezifisch zusammenwirken und man sie gemeinsam überwinden muss. Im Schwarzen Feminismus spricht man von Intersektionalität. Es reicht eben nicht zu sagen, dass wir einzig den Kapitalismus überkommen müssen und der Rest wird sich in der schönen neuen Welt automatisch lösen.
Würdest du sagen, die Linke hat in dieser Beziehung Fortschritte gemacht?
In Bezug auf Geschlechterverhältnisse hat sich viel gebessert, vor allem dank der Interventionen von feministischen Marxist*innen seit den 1970er Jahren. Wir sehen auf der Straße, welche Demos immer kleiner und welche, wie der achte März, immer größer werden. Der Anspruch, Unterdrückungsverhältnisse als miteinander verschränkt anzuerkennen, ist in den letzten Jahren deutlich stärker geworden. Trotzdem gibt es heute natürlich auch noch Kreise und Gruppen, die genau diese als Nebenwidersprüche betrachten.
Neben Ökofeminismus beschäftigst du dich viel mit Degrowth. Kannst du kurz erklären, was das genau bedeutet?
Am einfachsten erkläre ich das, in dem ich sage, was Postwachstum, oder Degrowth, nicht ist. Denn da gibt es viele Missverständnisse. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Postwachstum kein rein ökonomisches Konzept ist, auch wenn der Name so klingt. Es geht um eine Forderung nach sozialer und ökologischer Gerechtigkeit innerhalb planetarer Grenzen. Nicht um negatives Wachstum in allen möglichen Sektoren und Weltregionen.
Es ist völlig klar, dass Sektoren wie die erneuerbaren Energien oder auch der Care-Sektor wachsen und gedeihen sollen und andere, wie zum Beispiel der Braunkohle- oder Rüstungssektor, schrumpfen müssen. Genauso wenig dürfen wir Degrowth mit negativem Wachstum innerhalb eines Wachstumsparadigmas gleichsetzen. Degrowth ist keine Rezession, bei Degrowth geht es darum, den Wachstumsimperativ als solchen zu überwinden.
Degrowth ist auch kein freudloser Verzicht. Es geht eher darum zu evaluieren, was wirklich das subjektive Wohlbefinden steigert. Das kann zum Beispiel mehr Zeit mit Freund*innen sein, statt immer mehr Konsum. Wichtig zu betonen ist mir zudem, dass das Degrowth-Verständnis, auf das ich mich beziehe, nicht in dem Versuch aufgeht, eine systemische Krise auf einer individuellen Ebene zu lösen. Es geht viel mehr darum, der sozial-ökologischen Transformation den Weg zu ebnen.
In der Postwachstumsbewegung gibt es zwei Ansätze zur Aufwertung von Care-Arbeit: Einerseits Care als Commons, also als Gemeingut, und andererseits das Care-Einkommen. Wie stehst du dazu?
Viel davon geht auf feministische marxistische Debatten rund um die „Lohn für Hausarbeit“-Kampagne aus den 1970ern zurück. Diese war keine rein monetäre Forderung. Sie wollte darauf aufmerksam machen, dass der Kapitalismus immer ein ‚Außen‘ braucht. Er könnte es sich nicht leisten, Care-Arbeit angemessen zu entlohnen. Spannenderweise divergieren zwei der damaligen Initiatorinnen der Kampagne, Silvia Federici und Selma James, heute in ihren Ansätzen. Federici fokussiert sich auf eine Reorganisierung von Care in der Sphäre von gemeinschaftlichen, kollektiven Formen von unbezahlter Care-Arbeit. James hingegen fordert ein Care-Einkommen.
Ich habe selbst mehr zu Care als Commons geforscht. Aber ich glaube, dass es falsch ist, die beiden als Gegensätze zu betrachten. Es gibt durchaus die Möglichkeit über ein Care-Einkommen nachzudenken, das die Commonisierung von Care wahrscheinlich macht. Wichtig ist die Frage, ob ein Care-Einkommen ähnlich einem Grundeinkommen universell konzipiert wäre. Oder ob es nur an die Menschen ausgezahlt werden würde, die Care-Arbeit leisten.
Wir müssen in jedem Fall vorsichtig sein, zuerst eine Sichtbarmachung der Care-Arbeit zu fordern, indem wir sie in monetäre Sprache übersetzen und dann im zweiten Schritt anzunehmen, dass sie folglich sozial anerkannt wird. Wenn wir uns Berufsgruppen in bezahlter Care-Arbeit anschauen, sehen wir heute schon, dass das nicht funktioniert. Zumeist sind sie prekär und unterbezahlt.
Im Degrowth-Diskurs wird eine Verlagerung von immer mehr unbezahlter Care-Arbeit in die bezahlte Sphäre auch nicht als Lösung angesehen. Denn das verschiebt die Care-Krise lediglich, oft mit unterschiedlich starken Folgen, je nach Herkunft oder Geschlecht. Stattdessen muss es darum gehen, Raum und Zeit auch für unbezahlte Care-Arbeit zu schaffen – zum Beispiel durch eine allgemeine (Lohn-)Arbeitszeitverkürzung.
Werfen wir einen Blick auf die Praxis: In Österreich gab es im Jahr 2021 29 Femizide, dieses Jahr bereits neun. Das österreichische Innenministerium rät Frauen, in der Öffentlichkeit selbstbewusster aufzutreten, um sich zu schützen. Wie lässt sich den Femiziden deiner Meinung nach begegnen?
Auch wenn ich dazu nicht geforscht habe: Das ist eine klassische Form von Täter-Opfer Umkehr, ganz klar. Nicht darüber zu reden, wer die Person ist, die sexualisierte Gewalt ausübt, sondern andere Worte dafür zu finden, wie „das Kleid war zu kurz“, passiert leider immer noch ständig. In einem Patriarchat, das toxische Männlichkeiten (re)produziert, ist es der völlig falsche Ansatzpunkt, bei den Opfern sexualisierter Gewalt die Schuld zu suchen. Wir müssen viel eher schauen, wie wir von hegemonialen oder toxischen Männlichkeiten wegkommen.
Letztens auf einer Podiumsdiskussion in Zürich hat ein Teilnehmer gefragt, wieso er als weißer heterosexueller Cis-Mann seine Privilegien aufgeben sollte. Einerseits lässt sich natürlich von einem ethisch-politischen Standpunkt aus argumentieren, dass es moralisch richtig ist, Privilegien abzugeben, die auf Kosten anderer gehen. Andererseits aber muss man sagen, dass auch für Männer das Leben ohne Patriachat besser und lebenswerter sein könnte. Wegzukommen davon, dass ich als Mann keine Gefühle zeigen darf oder die Familie ernähren muss. Wir sehen zum Beispiel gerade bei Männern eine deutlich höhere Suizidrate. Ein Aufbruch von klassischen Rollenbildern und strikter Zweigeschlechtlichkeit wäre für alle Geschlechter vorteilhaft.
Was braucht es, um diese Rollenbilder aufzubrechen?
Diese Muster werden uns von frühster Kindheit an ansozialisiert. Es ist keinesfalls biologisch, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen, oder Protokoll schreiben. Der anarchistische Geograph Simon Springer hat gesagt, dass jedes Kind als Anarchist*in geboren wird, aber in den ersten vier Jahren eine prägende Sozialisierung der spezifischen Strukturen unserer Gesellschaft eingetrichtert bekommt. Wenn du nach deinem fünften Lebensjahr wieder ein*e Anarchist*in werden willst, verbringst du dein gesamtes Leben damit, diese Strukturen wieder zu verlernen.
Dieses unfassbar viele Verlernen ist ein komplexer Prozess und man – und dabei meine ich auch mich selbst – wird immer wieder zurückgeworfen. Wir müssen das reflektieren, aber sowohl uns selbst als uns auch innerhalb unserer Gruppen gegenseitig zugestehen, dass wir alle in diesem System erzogen worden sind und manchmal auf null zurückgeworfen werden.
Bis zur Abschaffung des Patriarchats und des Kapitalismus ist es wohl noch eine Weile hin. Für alle Leser*innen die sich jetzt denken: das Problem ist so groß, wo sollen wir denn da bloß anfangen – was können wir heute schon dafür tun?
Tatsächlich glaube ich, dass diese Lähmung, in die man manchmal ob der ganzen großen Probleme verfällt, dadurch zu brechen ist, dass man sich mit Menschen, die ähnlich denken, gemeinsam organisiert. Egal wie unperfekt die Praxis sein mag. Wir sollten vermeiden an Adornos „es gibt kein richtiges Leben im Falschen“ zu verzweifeln – das manövriert uns nur in eine handlungstheoretische Sackgasse. Es ist wichtig und empowernd, in eine kollektive Praxis zu kommen und Probleme integrativ mitzudenken, aber auch zu merken, dass das nicht immer perfekt klappt und fehlerfreundlich darin sein.
Interview: Sophie Gleitsmann & Fabian Hattendorf