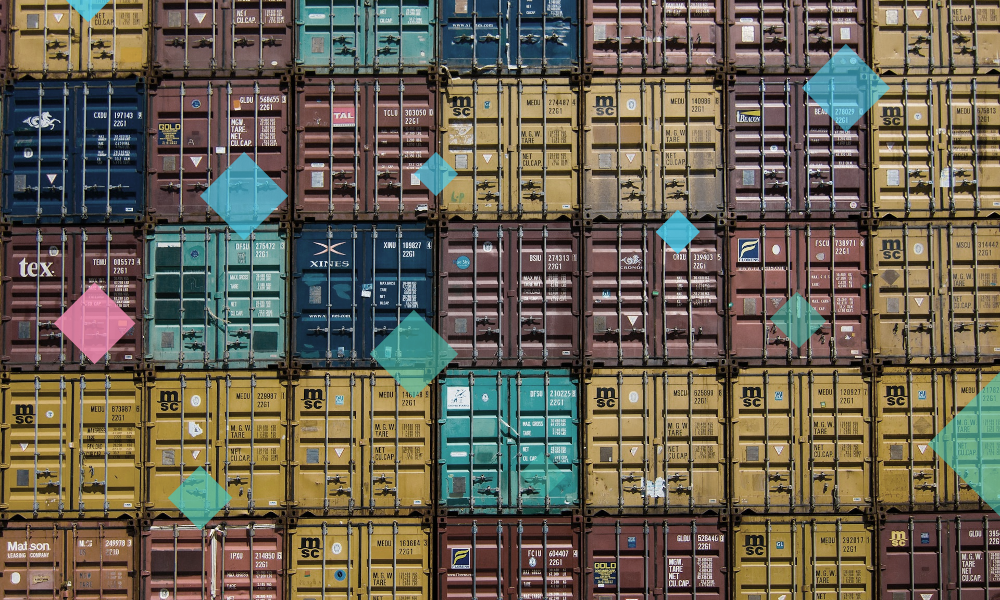Christian Kern fordert einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel in der EU. Doch bei CETA zeigte er, dass er zum dafür nötigen Bruch mit dem alten Kurs nicht bereit ist. Eine neue Politik wird nur gegen die Eliten möglich sein, nicht mit ihnen, meint Valentin Schwarz.
„Europa muss wieder gerecht werden“, schrieb Christian Kern in einem viel beachteten Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im September. Die EU stehe heute für Ungleichheit und Konzerninteressen und lasse zugleich „die Masse der Menschen mit ihren Problemen und Sorgen allein“.
Der Kanzler forderte einen Kurswechsel weg von der neoliberalen Kürzungspolitik, hin zu mehr Investitionen und sozialer Sicherheit. Dafür seien „neuen Allianzen in Europa für eine progressive Wirtschaftspolitik“ nötig, schrieb er, „die unseren Kontinent wieder vorwärts bringt.“
Neues System im Dienst der Konzerne
CETA war Kerns große Chance, eine solche Trendwende einzuleiten. Warum? CETA hat mit Handel und Kanada wenig zu tun – es geht um viel mehr. Das Abkommen soll einem neuen, internationalen System im Dienst der Konzerne den Weg bereiten. Sie könnten ihre Interessen dann noch einfacher als bisher durchsetzen.
Am bekanntesten sind die Sonderklagerechte, die Konzernen Milliardenklagen gegen demokratisch beschlossene Gesetze ermöglichen würden. Mit CETA soll ein neues, dauerhaftes System solcher Konzerngerichte entstehen. Dazu kommt die sogenannte „regulatorische Kooperation“. Wenn die EU oder Kanada neue Regulierungen planen, sollen Konzerne ein Vorab-Mitspracherecht erhalten – noch bevor Parlamente damit befasst werden.
Weiter auf falschem EU-Kurs
CETA reiht sich in die langjährige neoliberale EU-Wirtschaftspolitik ein, die sich seit Ausbruch der Eurokrise verschärft hat. In den letzten Jahren wurden Kürzungen im Staatshaushalt und Sozialsystem, die sogenannte Austeritätspolitik, zum europäischen Gesetz gemacht.
Die EU-Kommission erhielt mehr und mehr Möglichkeiten, diese Vorgaben mit Überwachung und Strafzahlungen durchzusetzen. Sozialstaat, Arbeitsrechte und Löhne geraten seither in immer mehr Staaten unter Druck. Griechenland ist nur das Extrembeispiel dieses neoliberalen und autoritären Kurses. Doch mittlerweile steckt er in einer Sackgasse.
Der Austeritäts-Fetischismus sorgt für kein neues Wachstum, sondern vertieft die Rezession. Auch die Billionen, die die Europäische Zentralbank ins Bankensystem pumpt, sorgen eher für neue Finanzblasen als für realwirtschaftliche Nachfrage und einen Aufschwung.
Die Pläne der Eliten, die Austeritätspolitik weiter zu vertiefen, wie per Wettbewerbspakt und danach im Fünf-Präsidenten-Report geplant, kommen nicht vom Fleck. Da sie im Inneren kein Wachstum schaffen können, soll es nun von außen kommen: durch eine Deregulierung des internationalen Handels, etwa durch CETA und TTIP – und auf Kosten von Mensch und Umwelt.
Kern hätte Debatte erzwingen können
CETA ist für die Eliten also ein Strohhalm. Sein Scheitern wäre für sie eine schwere Niederlage und ein großer Sieg für die europäische Bewegung dagegen. Die Chancen dafür stehen auch nach der Unterzeichnung nicht schlecht. Schließlich muss das Abkommen noch im EU-Parlament und anschließend in 38 nationalen und regionalen Abstimmungen bestätigt werden. Dazu kommen mehrere Verfahren vor Höchstgerichten.
Doch Christian Kern wird bei diesem möglichen Sieg über die neoliberalen Eliten keine Schlüsselrolle spielen. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung und seiner Partei gegen CETA ist, unterschrieb er das Abkommen. Mit einem Nein hätte der Kanzler der in die Krise geratenen neoliberalen EU-Wirtschaftspolitik einen entscheidenden Schlag versetzen und eine Debatte über den Kurswechsel erzwingen können, den er im eingangs zitierten Kommentar fordert.
„Reputation“ und „Standort“ sind ihm wichtiger
Als Gründe nennt Kern „unsere internationale Reputation, auch als Wirtschaftsstandort.“ Zudem habe er keine Bündnispartner in anderen Ländern finden können. Das ist eine schauderhafte Begründung für jemanden, der sich einen Kurswechsel auf die Fahnen schreibt.
Kern zeigt damit drei Dinge: Erstens ist ihm ein Bruch mit der bisherigen EU-Wirtschaftspolitik keinen Konflikt mit den Verantwortlichen wie Merkel und Juncker wert, der die „Reputation“ seiner Regierung ankratzen könnte.
Zweitens bekräftigt er den neoliberalen Standortwettbewerb, den die EU künstlich anheizt und der eine Abwärtsspirale bei Löhnen und Schutzstandards, bei Steuern auf Vermögen und Profite in Gang hält.
Drittens leistete Kern auch beim Thema Bündnispartner einen Offenbarungseid: Als sich mit der Wallonie und Brüssel Verbündete fanden, unterstützte er beide nicht, sondern kritisierte gar, dass sie „den Entscheidungsprozess blockiert[en].“
Nicht bereit zum Bruch
Keine Frage, Kern war in einer schwierigen Lage: Der Druck von EU-Kommission und anderen Regierungen für CETA war groß, ebenso jener aus Österreich dagegen. In dieser Situation entschloss sich Kern dagegen, einen Bruch mit den neoliberalen Mechanismen der EU zu wagen.
Bei einem solchen Bruch hätte sich Kern auf eine EU-weite Bewegung stützen können, die so unterschiedliche Gruppen wie Gewerkschaften und Umwelt-NGOs, BäuerInnen und Unternehmen, kirchliche und linke Vereinigungen umfasst. Allein in Österreich sind über 60 Organisationen im Bündnis „TTIP stoppen“ versammelt.
Doch sie alle gehören für Kern offenbar nicht zu den „neuen Allianzen für eine progressive Wirtschaftspolitik“, die er in seinem Kommentar einfordert. Den Kurswechsel in der EU will er nicht mit einer der breitesten und stärksten Bewegungen der letzten Jahre durchsetzen, sondern mit anderen sozialdemokratischen Regierungen.
Gegen die Eliten statt mit ihnen
Die politisch wichtigsten sozialdemokratischen Regierungsparteien in der EU sind jene in Frankreich, Italien und Deutschland.
Doch was für ein Bündnispartner ist François Hollande, der, als Griechenland um ein Ende der Verarmungspolitik kämpfte, sechs Monate lang keinen Finger rührte? Der sich erst einschaltete, als die linke Regierung aufgegeben hatte, um das Kapitulationsangebot mitzuverfassen? Was ist von Matteo Renzi zu erwarten, der gegen die Gewerkschaften den Kündigungsschutz schwächte? Was von Sigmar Gabriel, der die „Schuldenbremse“, ein Kernstück neoliberaler Budgetpolitik, stolz als „sozialdemokratische Erfindung“ bezeichnet?
Was für eine Strategie ist das, die auf Leute baut, die jahrelang das umsetzten, was jetzt geändert werden soll? Eine neue Politik gibt es nur gegen Hollande, Renzi und Gabriel, nicht mit ihnen. Dazu braucht es neue AkteurInnen, die aus Bewegungen wie jener gegen CETA und TTIP entstehen können. Immerhin ist diese einem Sieg so nahe wie kaum eine Bewegung der letzten Jahre.
Mit dem Auslassen dieser Chance zeigt Kern, dass er ein Politikverständnis hat, mit dem er seinen geforderten Kurswechsel nicht erreichen kann.
Die Rechte hat es verstanden
Wie erfolgreich eine Strategie gegen das EU-Machtgefüge sein kann, zeigt derzeit die Rechte. Sie regiert in weniger Staaten als die Sozialdemokratie, ist aber ungleich durchsetzungsstärker. In der Flüchtlingspolitik blockieren Orban und Kaczyński jede solidarische Maßnahme, auch gegen den Druck aus Deutschland. Statt den Kompromiss suchen sie den Bruch mit den etablierten Methoden der EU. Damit ziehen sie das politische Feld europaweit nach rechts.
In einer tiefen Krise der alten Ordnung, wie wir sie derzeit erleben, ist nicht Systemkonformität erfolgreich, sondern das Suchen und Finden der richtigen Brüche. Der notwendige wirtschaftspolitische Kurswechsel in der EU kann nur über gezielt herbeigeführte Konflikte erreicht werden. Je breitere Teile der Gesellschaft sich in diesen Konflikten engagieren, desto größer die Erfolgschancen, wie das bei CETA der Fall ist.
Wer das wie Christian Kern nicht versteht, kann weder die tiefe politische und ökonomische Krise in der EU lösen noch den Aufstieg der extremen Rechten aufhalten.
Valentin Schwarz ist mosaik-Redakteur.