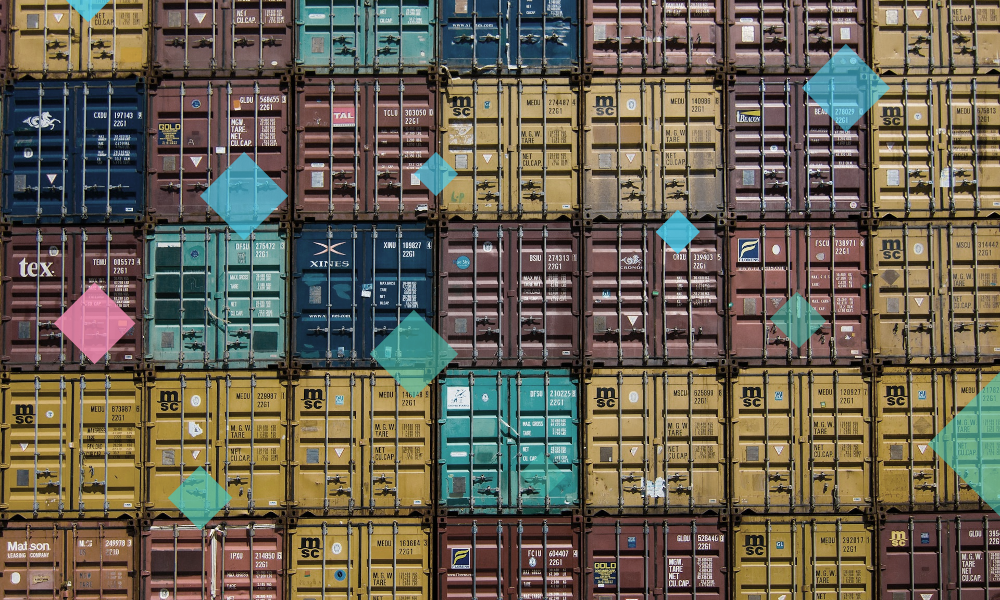Am 21. Januar vor 100 Jahren starb Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin). Zu seinem Todestag nimmt Anselm Schindler seine Ansätze unter die Lupe.
Der Leichnam von Wladimir Iljitsch Uljanow, Lenin, liegt heute als Touristenattraktion in feinem Anzug in einem Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau. Während das Putin-Regime gegen die Kommunist:innen von damals hetzt, weil sie nicht in das russisch-nationalistische Narrativ passen, gedenken in diesen Tagen Linke weltweit Lenin und seinen Ideen. Ein guter Anlass, um diese auf ihre Aktualität abzuklopfen.
Kapitalismus nach Lenin
Der Kapitalismus hat seit Lenins Tod nichts von seinem Schrecken eingebüßt. Im Gegenteil: Heute leben weltweit Milliarden Menschen in Armut. Jedes Jahr sterben Tausende an Grenzen, während ein paar Reiche um die Welt jetten. Auch heute werden Kriege um Ressourcen und Märkte geführt. Zusätzlich gibt es Atomwaffen – und Lenin wusste auch noch nichts von der Klimakrise. Er behält also Recht mit der an Marx angelehnten These: Der Kapitalismus kann weder dauerhaft gebändigt noch weg reformiert werden, er muss gestürzt werden.
In „Was Tun?“, einer seiner wichtigsten programmatischen Schriften, betonte Lenin den subjektiven Faktor – also die Bedeutung bewusst handelnder Menschen, ihrer Organisationen und ihres Willens zur Veränderung der Welt.
Die Kaderpartei
Gemeinsam mit anderen baute Lenin eine revolutionäre Kampfpartei auf: die Bolschewiki. Ziel der Bolschewiki war es, den kapitalistischen Staat zu stürzen und einen sozialistischen Staat aufzubauen, der die Wirtschaft kontrolliert und den menschlichen Bedarf zu ihrem Ausgangspunkt macht. Die Bolschewiki verzeichneten einige Erfolge. In der Sowjetunion stiegen Lebenserwartung, Alphabetisierung, Bildungsgrad und die Emanzipation von Frauen sprunghaft an. Kein kapitalistisches Land mit ähnlicher Bevölkerungsgröße schaffte eine derzeit schnelle Entwicklung von einer feudalen bäuerlichen zu einer industrialisierten Gesellschaft. Gleichzeitig kosteten die Entwicklungen viele Menschenleben. Auf die Bedrohung durch den Faschismus, durch imperialistische Angriffe und Spaltungslinien innerhalb der aus den Bolschewiki hervorgegangenen Kommunistischen Partei der Sowjetunion reagierten Lenin und Co. mit harter Hand. Das wurde nicht zuletzt Leo Trotzki und anderen Weggefährt:innen Lenins zum Verhängnis. Gäbe es nicht gemäßigte Alternativen zur leninschen Kaderpartei?
Gemäßigte Alternativen
Gab es. Nur haben sie sich nicht sonderlich bewährt. Der Reformismus der Sozialdemokratie wurde zu einem neoliberalen Herrschaftsinstrument und hat in den letzten Jahrzehnten Arbeiter:innenrechte abgebaut anstatt sie zu verteidigen. Ansätze, die auf Sozialismus ohne Umsturz setzten, wurden niedergeschlagen. Zum Teil mit Kanonen und Bomben (das Chile Salvador Allendes in den frühen 70ern), zum Teil durch ökonomische Erpressung (das Griechenland Syrizas der 2010er Jahre). Es braucht also eine revolutionäre Partei, die in der Lage dazu ist, im richtigen Moment die Systemfrage zu stellen und aus diffusen Massenbewegungen eine Revolution zu machen. Womit noch nicht die Frage beantwortet ist, wie sich eine solche Organisation heute am besten aufbauen lässt. Oder die Frage, wie eine Kaderpartei geschaffen werden kann, die keine Gewaltexzesse und Säuberungswellen mit sich bringt.
Inspirierend ist dabei die kurdische Freiheitsbewegung. Sie verfügt mit der Arbeiter:innenpartei Kurdistans (PKK) über eine Organisation, die dem leninistischen Kader-Ansatz folgt und mit ihren Wurzeln in der kommunistischen Bewegung der Türkei in einer marxistisch-leninistischen Traditionslinie steht. Die PKK beweist durch die Rolle, die sie in den Emanzipationsbewegungen in türkisch- iranisch- und irakisch- Kurdistan sowie in Rojava/Nordosyrien einnimmt, dass der leninistische Ansatz reformierbar ist. Zu dieser Entwicklung hat in den vergangenen Jahrzehnten auch der Aufbau von autonomen Frauenstrukturen innerhalb der kurdischen Freiheitsbewegung beigetragen.
Imperialismus-Analyse
Der Imperialismus-Begriff ist heute wieder in aller Munde. Allerdings als moralisches Urteil über Gegner:innen des „eigenen“ Machtblocks und nicht als das analytische Werkzeug, als das Lenin den Begriff verstand. Auch heute kann er ein hilfreiches Mittel sein, um sich zwischen all der Kriegspropaganda aus Moskau, Washington, Berlin und Peking zurechtzufinden. Dafür ist ein bisschen Vorwissen in dem Bereich nützlich, den Marx als politische Ökonomie bezeichnete. Doch auch ohne dem ist Lenins Standardwerk „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ recht unkompliziert geschrieben. Lenin beschreibt den Imperialismus als Entwicklungsstufe des Kapitalismus. Dabei macht er deutlich, dass die Grundlage des modernen Kapitalismus nicht die freie Konkurrenz, sondern die Monopole sind. In der marxistischen Wirtschaftswissenschaft bedeutet Monopol nicht, dass ein Konzern in seinem Bereich der einzige ist, sondern, dass er eine große Machtstellung auf dem Markt hat.
Die Monopole, die Lenin beschreibt, kontrollieren heute die halbe Welt – Microsoft, Amazon, Coca Cola oder Saudi Aramco. Lenin geht davon aus, dass es die Monopole sind, die die größte Machtstellung im Kapitalismus haben. Und dass die Konkurrenz der Monopole der verschiedenen Länder die Hauptursache für die Kriege zwischen diesen Ländern ist. Was angesichts der Rolle, die zum Beispiel Öl- und Gaskonzerne in den Kriegen und Auseinandersetzungen von der Ukraine bis Mali spielen, plausibel scheint. Diese Erkenntnis unterstützt dabei, Kriegsbegründungen diverser Parteien als das zu erkennen, was sie sind: Propaganda, der man nicht auf den Leim gehen sollte.
Internationalismus
Die Bolschewiki zogen aus ihrer Imperialismus- und Kriegsanalyse den Schluss, dass es die Aufgabe der Linken sei, im eigenen Land gegen Aufrüstung und Krieg zu mobilisieren. Die von Lenin, Trotzki und Anderen angeführte kommunistische Bewegung verstand sich nicht als russisch, sondern als internationalistisch: Sie kam auch deshalb an die Macht, weil die Menschen in Russland wollten, dass der Erste Weltkrieg endet.
Innerhalb der kommunistischen Bewegung nahm Lenin eine besonders strikte Anti-Kriegs-Position ein. Er verurteilte die Zustimmung zu Kriegskrediten durch die Sozialdemokratie in Deutschland zum Beginn des Krieges und warb für Friedensverhandlungen mit dem deutschen Kaiserreich zu seinem Ende. Die Argumente seiner auch innerlinken Gegner:innen, die damals für eine Fortsetzung des Krieges agitierten, erinnern an die Stimmen, die heute für die Nato und für Waffenexporte in die Ukraine werben. Hätten im 20. Jahrhundert alle Linken so gehandelt wie Lenin, hätte es den Ersten Weltkrieg vielleicht gar nicht gegeben. Jenseits des Personenkults bleiben also einige Aspekte seiner Analysen, derer wir uns auch heute noch annehmen sollten.
Foto: Nicolas Dmitritchev