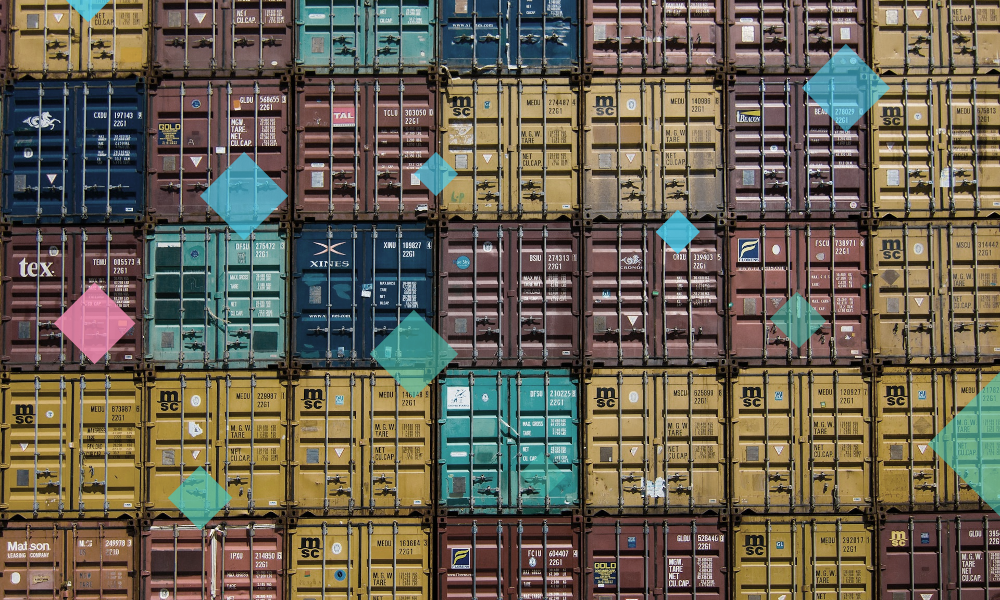Ende Februar 2016 begann die politische und soziale Auseinandersetzung um das geplante „Arbeitsgesetz“, die Loi travail, in Frankreich. Bei Abschluss dieses Artikels war kein Ende des Konflikts abzusehen. Er dürfte sich auch den Sommer hindurch fortsetzen.
Es ist nicht zu Ende. Die Regierung verweigert bislang jedes ernsthafte Nachgeben. Und die Gewerkschaften ihrerseits – mit Ausnahme der rechtssozialdemokratisch geführten CFDT, denn dieser Dachverband (der zweitstärkste von fünf) unterstützt die Regierungslinie – machen bislang kein Anstalten zum Einknicken. Der umstrittene Entwurf für eine „Reform“ des französischen Arbeitsrechts, um den es geht, wurde am 17. Februar dieses Jahres publik, die ersten Demonstrationen dagegen fanden am 9. März statt. Aber auch über drei Monate danach bleibt Dampf unter dem Kessel.
Am 23. und am 28. Juni sind erneute gewerkschaftliche „Aktionstage“ mit Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen geplant. Am 28. Juni wird der Senat, das parlamentarische „Oberhaus“, über den Gesetzentwurf abstimmen. Im Juli kommt dieser dann in die Nationalversammlung, die bei Uneinigkeit der beiden Parlamentskammern das letzte Wort hat, zur entscheidenden Lesung zurück. Wahrscheinlich wird sich der Konflikt auch noch den Sommer hindurch ziehen, und in Kreisen der CGT (des stärksten gewerkschaftlichen Dachverbands in Frankreich) ist bereits jetzt die Rede von weiteren Demonstrationen auch im September, um notfalls eine Rücknahme des Gesetzes zu erreichen. Dass bereits verabschiedete Gesetze zurückgenommen werden müssen, hat man in Frankreich schon erlebt, zuletzt beim Kampf gegen den Contrat première embauche („Ersteinstellungsvertrag“), also gegen den Angriff auf den Kündigungsschutz für die Unter-30-Jährigen im Frühjahr 2006. Allerdings erfordert dies ein Kräfteverhältnis zugunsten der Gewerkschaften, das bislang nicht garantiert ist.
Sinkende Mobilisierungsstärke, anhaltender Protest
Im Vergleich zu früheren sozialen Konflikten wie dem um den Ersteinstellungsvertrag, aber auch um Renten-„Reformen“ im Frühjahr 2003 sowie im Sommer und Herbst 2010, fallen die Demonstrationen derzeit zahlenmäßig zurück. Eine Million Menschen bei Demonstrationen in ganz Frankreich war das Maximum, das erreicht wurde. Und die Mehrzahl der insgesamt neun „Aktionstage“ zwischen dem 9. März und dem 14. Juni dieses Jahres lag bei circa einer Viertelmillion Demonstrantinnen und Demonstranten auf überregionaler Ebene. Bei früheren, vergleichbar intensiven sozialen Konflikten gingen an Spitzentagen bis zu drei Millionen Demonstrierende auf die Straße. Dennoch unterstützen auch Ende Juni noch rund sechzig Prozent der öffentlichen Meinung in Umfragen die Protestmobilisierung. Und bei keinem Institut ergibt sich eine Mehrheit gegen die sozialen Proteste oder für den Gesetzentwurf – den laut einer Befragung von Ende Mai dieses Jahres volle 13 Prozent in der vorliegenden Fassung gutheißen.
Dass die Demonstrationen dennoch auf quantitativer Ebene nicht so stark ausfallen, liegt daran, dass einerseits bereits seit Mitte März die Polizei regelmäßig für gewaltsame Zwischenfälle bei den Demonstrationen sorgte. Andererseits und in Reaktion darauf hat sich ein wachsender Teil der Jugendbewegung – die einen besonders dynamischen Teil des Protestspektrums darstellt – radikalisiert. Aktionen gegen die Polizeikräfte, Glasbruch am Rande von Demonstrationen, aber auch massive Tränengaseinsätze, regelmäßige Helikopter-Überflüge und Einkesselungen gehören inzwischen fast zu jedem Straßenprotest.
Das gilt jedenfalls für Paris – und sogar noch stärker für Städte wie Rennes, Nantes und teilweise auch Toulouse, wo anarchistische und autonome Bewegung traditionell stark sind. In Nantes und Rennes herrschte zeitweilig eine regelrechte Bürgerkriegsatmosphäre. Die Einsatzkräfte schossen mit Gummigeschossen, in Rennes verlor ein 21-Jähriger dabei Ende April dieses Jahres ein Auge. Schon seit März verbot die Präfektur in Rennes den Demonstrierenden den Zugang zur Innenstadt, die von der dortigen Bürgermeisterin in schlichten Worten als „das größte Einkaufszentrum der Bretagne“ charakterisiert wurde, was eine erhebliche eskalierende Wirkung hatte.
Aus diesen Gründen sympathisieren zwar viele Lohnabhängige, vor allem solche mit Familienleben, mit den Anliegen der Protestierenden. Körperlich halten sie sich jedoch mehrheitlich von den Demonstrationen eher fern und überlassen Jüngeren das Feld.
Lange Dauer, harter Kern
Zugleich kennzeichnet sich die aktuelle Protestbewegung durch ihre außergewöhnlich lange Dauer sowie durch die Existenz eines großen und noch wachsenden, sich radikalisierenden „harten Kerns“. Letzterer ist zur Konfrontation mit den Polizeikräften, aber auch zu Blockadeaktionen bei Unternehmen und Treibstofflagern, zu Gleisbesetzungen und Stromunterbrechungen bereit. Ca dure et c’est dur („Es dauert lange, und es ist hart“): In dieser prägnanten Formulierung fasste eine Politikerin der radikalen Linken – Christine Poupin von der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA) – am 12. Juni diese beiden kennzeichnenden Merkmale der diesjährigen Proteste zusammen.
Sollte das umkämpfte „Arbeitsgesetz“ doch noch durchkommen, dann müsste die regierende Sozialdemokratie zweifellos einen sehr hohen politischen Preis dafür zahlen, büßte sie doch in der laufenden Auseinandersetzung die Unterstützung eines Großteils ihrer vormaligen Wählerinnen- und Wählerbasis ein. Doch für die Gewerkschaften steht noch mehr auf dem Spiel, betrachten sie doch das geplante „Arbeitsgesetz“ als Rückschritt hinter die letzten achtzig Jahre Entwicklung in der Arbeitsgesetzgebung. Das heißt konkret, hinter die arbeitsrechtlichen Weichenstellungen, die infolge des Generalstreiks im Mai/Juni 1936 und unter der Linksregierung des Front populaire vorgenommen wurden (Front populaire wird extrem grobschlächtig mit „Volksfront“ übersetzt, wobei das Adjektiv populaire auf eine Zugehörigkeit zu den sozialen Unterklassen und sicherlich nicht auf den deutschsprachigen „Volks“-Begriff verweist).
Der Gesetzentwurf und seine Wurzeln
Der vorliegende Gesetzentwurf geht in weiten Teilen einerseits auf „Empfehlungen“ der EU-Kommission vom 13. Mai 2015 zurück. Andererseits jedoch verweist er auf Vorschläge zur „Neubegründung der sozialen Beziehungen“ (refondation sociale), die das organisierte Kapital in Gestalt des französischen „Arbeitgeber“-Verbands MEDEF zwischen Dezember 1999 und Juni 2000 formuliert hat. Er sieht insbesondere vor, den Abschluss von Kollektivvereinbarungen durch Minderheitsgewerkschaften auf Unternehmensebene zu erleichtern. Bislang benötigen Minderheitsgewerkschaften einen Stimmenanteil von 30 Prozent, um eine Vereinbarung zu unterzeichnen, doch verfügen die Mehrheitsgewerkschaften ab einem Anteil von fünfzig Prozent über ein droit d’opposition. Dieses „Vetorecht“ soll ausgehebelt werden. Ferner sollen Unternehmensvereinbarungen auf für die Lohnabhängigen ungünstige Weise von Branchenvereinbarungen, aber auf dem Gebiet der Arbeitszeitpolitik auch vom Gesetz abweichen können.
Zudem ist geplant, dass die mit (Minderheits-)Gewerkschaften getroffenen Vereinbarungen – ebenfalls besonders auf dem Gebiet der Arbeitszeiten – auch die Bestimmungen im Arbeitsvertrag des oder der einzelnen Lohnabhängigen aushebeln dürfen, wenn dies nur mit „einer positiven Wirkung auf die Schaffung oder Bewahrung von Arbeitsplätzen“ gerechtfertigt wird. Lohnabhängige, die sich einer solchen Neuerung verweigern und auf ihren Arbeitsvertrag berufen, dürften demnach entlassen werden.
Bernhard (Bernard) Schmid, geboren 1971 in Süddeutschland, lebt seit 1995 in Paris. Er ist Jurist, freier Journalist und Buchautor. Seit Ende Februar berichtet er durchschnittlich jeden dritten Tag bei Labournet Germany über den Konflikt in Frankreich um das geplante „Arbeitsgesetz“; nähere Einzelheiten und der Fortgang der Ereignisse können dort ausführlich verfolgt werden.