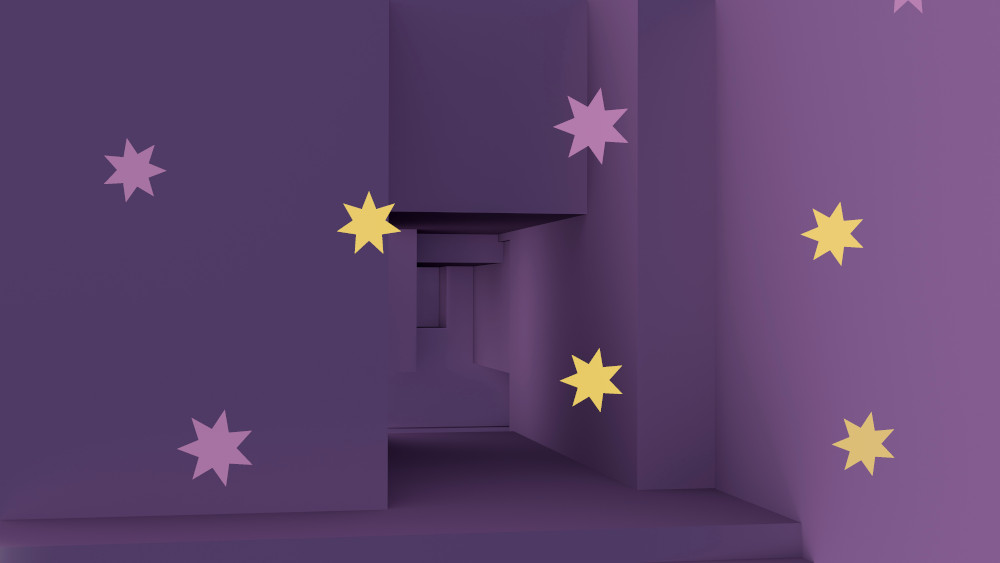In einem offenen Brief formulieren über 100 Wissenschaftler*innen Forderungen für eine gerechte Wohnungspolitik. Dazu gehören auch die Architektin Gabu Heindl und die Stadtplanerin Bettina Köhler. Mosaik-Redakteurin Franziska Wallner hat mit ihnen über einen notwendigen Mietenstopp, den Mythos der „kleinen Vermieter*innen“ gesprochen und erfahren, dass es nicht reicht, Delogierungen auszusetzen.
Die Corona-Pandemie bedeutet für alle Ausnahmezustand. Neben der Vorgabe, Leben zu retten, ist die nächste Priorität der Regierung augenscheinlich, „die Wirtschaft“ am Leben zu halten und, damit zusammenhängend, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu stabilisieren. Milliarden an Staatshilfen fließen. Wie in vergangenen Krisen stellt sich auch jetzt wieder die Frage: Wer gewinnt oder verliert durch die Krise? Wer wird eigentlich zur Kasse gebeten, und wer wird großzügig außen vor gelassen? Eine Gruppe an über StadtplanerInnen und WissenschaftlerInnen hat nun einen offenen Brief veröffentlicht, der das hochpolitische Thema Wohnen in den Fokus stellt.
Mosaik: Gemeinsam mit Stadtplaner*innen und Wissenschaftler*innen habt ihr einen offenen Brief zum umkämpften Thema „Wohnen“ im Kontext der Krise verfasst – warum und worum geht’s euch?
Gabu Heindl und Bettina Köhler: Ganz kurz gesagt: Es gibt auch in Wien zu viele Menschen, die ganz speziell in dieser Quarantäne-Zeit entweder zu schlechte Wohnbedingungen haben, zu teure Wohnungen, gar keine Wohnungen oder durch die Krise in Situationen geraten, die sie spätestens wenn sie Miet-Stundungen zurückzahlen müssen, in Schwierigkeiten bringen werden. Im Prinzip spitzt sich während der COVID-19 Krise das zu, was auch schon vor der Krise in der Wohnpolitik problematisch war. Es geht uns um die kurzfristigen wie auch strukturellen Maßnahmen, die es braucht, ebenso wie noch grundsätzlicher: um die Konditionen der Wohnpolitik, die sich in Zukunft ändern müssen. Und das sowohl im globalen Maßstab als auch im Kleinen: also z.B. hinsichtlich der Standards von Höhe und Größe eines Zimmers.
Ganz pragmatisch reihen wir uns dabei auch in eine europäische Debatte ein, in deren Kontext eine Reihe an Initiativen und Petitionen entstanden sind (so zB. in Deutschland, Großbritannien oder Schweden). In Österreich zum Beispiel die Petition „Mietenstopp in Corona-Krise“, die sich an die österreichische Bundesregierung richtet und weiterhin zu unterzeichnen ist. Politisch geht es uns für die Zeit nach dieser Gesundheitskrise um nichts weniger, als die Spekulation mit Wohnraum zu stoppen und stattdessen Wohnen als öffentliches Interesse und als Gemeinwohlagenda zu definieren. Damit ist letztlich auch angesprochen, mit welchen gesellschaftlichen Verpflichtungen Eigentum einhergeht.
Ihr sagt, die Corona-Krise ist eine Verteilungsfrage. Was meint ihr damit genau in Bezug auf Wohnen und städtischen Raum?
Wir meinen damit, dass die derzeit gesetzten Maßnahmen ungleich wirken – je nachdem wie Menschen wohnen, also wie beengt, aber auch mit wieviel oder wie wenig Freiraum und öffentlichem Raum im Wohnumfeld. Auch bei der Frage, wer für die Krise zahlen wird, bahnt sich eine ungleiche Verteilung an. Und wenn wir uns den Aufwand und die Mühe ansehen, die es braucht, um an Unterstützung zu kommen – das liegt alles bei den Mieter*innen, sie müssen bittstellen, obwohl sie oftmals ohnehin schon in prekären Lebenssituationen sind. Das könnte genauso gut bei den vermietenden Immobilieneigentümer*innen liegen.
Ihr fordert eine faire Kostenteilung der Krise und meint: „Es gilt, mit der neoliberalen Logik einer Privatisierung der Gewinne und Vergesellschaftung der Verluste zu brechen.“ Wie soll das konkret aussehen?
Auch hier geht es wieder um zweierlei – einerseits um akute Maßnahmen und andererseits die generelle Infragestellung dessen, wie aus Wohnen, das als Menschenrecht aufzufassen ist, in letzter Zeit ein Anlageprodukt geworden ist. Das Argument, das von Wirtschaftsseite in dieser Debatte häufig kommt, ist, dass die Vermieter*innen ja eh ihre Steuern zahlen – warum sollen Mieter*innen also nicht für ihre Wohnung zahlen? Miete als leistungsloses Einkommen nicht nur zu stunden, sondern wirklich auszusetzen, trifft diejenigen, die im großen Stil vermieten, viel weniger als wenn Menschen mit niedrigen Einkommen in zwei oder drei Monaten ihre Mietschulden plus die laufende Miete, die sie sich auch schon davor kaum leisten konnten, nachzahlen müssen.
Es werden hier auch gerne die „kleinen Vermieter*innen“ vorgeschoben, die dann keine Einnahmen mehr haben oder kein Geld mehr, um ihre Kredite zurückzuzahlen. Diese sollen um Unterstützung ansuchen können. Einer WIFO-Studie, die wir auch in unserem Brief zitieren, ist aber zu entnehmen, dass von den aus Vermietungen oder Verpachtungen lukrierten Einnahmen nur rund fünf Prozent an das untere Einkommensdrittel gehen. Hier werden also nicht nur Tatsachen verzerrt, sondern es wird vernachlässigt, dass der viel größere Teil der kapitalträchtigen Vermieter*innen Gesellschaften sind, für die Wohnen eine Kapitalanlage geworden ist. Staatliche Unterstützung für Mietzahlungen bedeute auch, dass öffentliche Gelder direkt dahin fließen.
Da würde ich gern anknüpfen, weil Wiener Wohnen hat Delogierungen ja ausgesetzt, auch die Bundesregierung hat unterschiedliche Maßnahmen im Bereich Wohnen getroffen. Warum sind die nicht genug?
Diese Schritte sind wichtig. Aber etwa in Sachen Mietbefristung hat sich fast nichts geändert. Ganz konkret gibt es auch in den aktuellen Sonderregelungen auf Seiten der Mieter*innen kein Recht, dass eine Befristung verlängert wird, sondern nur die Möglichkeit einer einvernehmlichen Verlängerung. Das ändert wenig an der Situation, die ohnehin bei befristeten Mietverträgen gegeben ist – dass man in der ständigen Sorge und Abhängigkeit von den Vermieter*innen lebt, ob der Mietvertrag nach einigen Jahren verlängert wird oder nicht. Nicht mal jetzt, in dieser nie dagewesenen Situation, ringt sich die Politik dazu durch, zu sagen: Es ist verbindlich, dass der Vertrag nicht ausläuft. Auch bei den Stundungen ist es so, dass bis zu vier Prozent Zinsen verlangt werden können. Nochmal: Wie soll sich jemand, der oder die sich die Miete sowieso nur schwer leisten kann, in vier, fünf Monaten ein Vielfaches davon zurückzuzahlen?
Als eine gezielte Sofortmaßnahme fordert ihr unter anderem die Evakuierung der Flüchtlingslager – ein brandaktuelles Thema, Österreich nimmt ja keine einzige Person auf – und die Öffnung von Hotels und leerstehenden Häusern für diese Menschen und auch für Obdachlose. Wie können wir Druck aufbauen, dass diese Forderungen nicht nur leere Worte bleiben?
Wie prekär die Situation gerade ist, merken selbst die, die jetzt eine Wohnung haben. Das zusammenzudenken mit der Situation in den Lagern, könnte eine Chance sein, im öffentlichen Bewusstsein Druck aufzubauen. Es gibt auch eine Macht der Zahlen. Es schadet nicht, aufzuzählen, wie viele Hotelzimmer leer stehen, wie viel Raum ja tatsächlich vorhanden ist, und das in Relation damit zu setzen, wie wenig Geflüchtete die Länder aufnehmen. Zum Beispiel im Fall von Österreich bislang null. Das gehört im Prinzip skandalisiert.
„Die Krise als Chance sehen“ – diesem Satz können viele mittlerweile außer Zynismus nicht mehr viel abgewinnen. Ich habe ihn in eurem Brief auch entdeckt. Wo liegt die Chance und wie schaffen wir es, den Zynismus kleiner und die Solidarität größer werden zu lassen?
Wir gehen davon aus, dass die Welt gerade neu ausverhandelt wird. Es werden Dinge in Frage gestellt, die bis vor kurzem ganz selbstverständlich waren. Umgekehrt sind jetzt Sachen möglich, die kurz zuvor noch undenkbar waren. Sachen werden neu bewertet, das kann Möglichkeitsfenster öffnen – aber natürlich auch schließen. Gerade jetzt geht es darum, nicht zynisch zu werden, nicht aufzugeben. Jetzt ist ein Moment, zu sagen: So kann es nicht weitergehen – und das an etwas so grundlegendem wie Wohnen deutlich zu machen. Für Wien ist das Thema komplexer zu fassen und schwieriger in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ja durch 60 Prozent Gemeindebau und gemeinnützigen Wohnbau für viele Menschen tatsächlich guter Wohnraum gesichert ist.
Aber diejenigen, die den Zugang dazu nicht haben – weil sie zum Beispiel für den Gemeindebau nicht lange genug in Wien gelebt haben oder für den geförderten Wohnbau keine Eigenmittel haben – wohnen genau so prekär wie in anderen Städten, von denen gravierende Wohnprobleme bekannt sind. Es geht also darum, an vernachlässigte Erfahrungen von öffentlichem Wohnungsbau anzuknüpfen, zugleich neue Instrumente zu entwickeln, aber auch solidarische kollektive Wohnformen als Alternativen aufzuzeigen, die nicht nur Gemeindebau heißen werden. Angemessen und selbstbestimmt wohnen zu können – das soll während und nach der Corona-Krise schlichtweg für alle gelten.
Den offenen Brief findet ihr hier.
Interview: Franziska Wallner