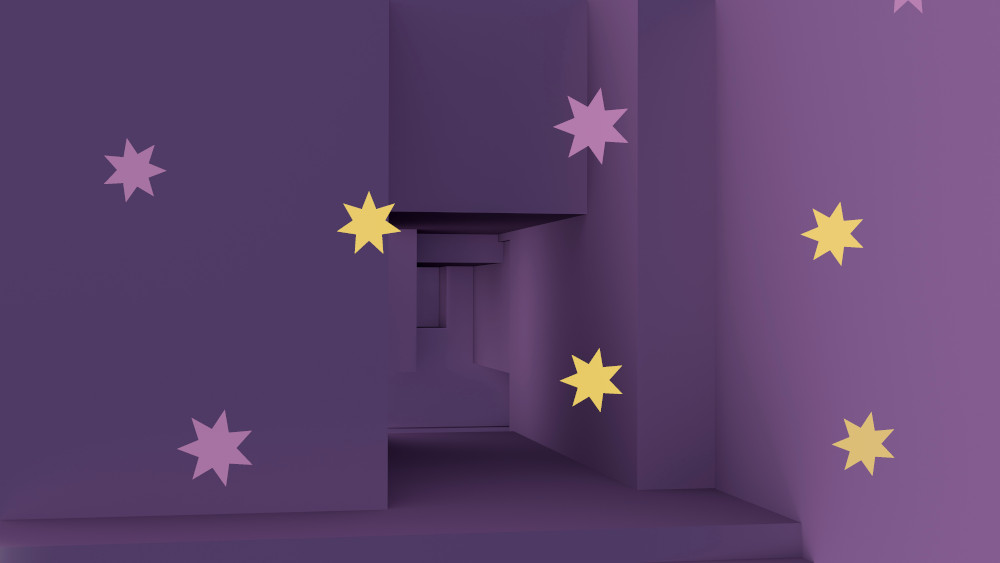Die stückweise Verdrängung von Sexarbeiterinnen aus dem öffentlichen Raum ist ein europäischer Trend, dem auch Wien folgt. Das „Wiener Prostitutionsgesetz 2011“, maßgeblich von den Interessen von Wirtschaft und Anrainer_innen beeinflusst, hat die Stoßrichtung vorgegeben: „Sichtbare“ Sexarbeit muss aus dem Stadtbild verschwinden. Doch das geht auf Kosten der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen. Das wirft die Frage auf: Wer hat eigentlich ein „Recht auf Stadt“ – und wer nicht?
Sexarbeiterinnen, die im öffentlichen Raum um Kunden werben, waren bis vor ein paar Jahren ein ganz alltäglicher Teil des Wiener Stadtbildes. Ob am Gürtel, im Prater, in der Linzer- oder Felberstraße – der sogenannte Straßenstrich war nicht nur ein Teil der Wiener Sexarbeitszene und Arbeitsplatz, er war auch Teil von Wien.
Der Straßenstrich in Wien – Reality Check
Als 2011, nach langen politischen und (scheinbar) öffentlichen Diskussionen, das neue „Wiener Prostitutionsgesetz 2011“ (WPG) von der rot-grünen Stadtregierung unter Federführung von Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) erlassen wurde, war vor allem die sogenannte sichtbare Anbahnung, also das Werben um Kunden im öffentlichen Bereich, von den rechtlichen Neuerungen betroffen. In der medialen Berichterstattung wurde vor allem ab 2010 eine Richtung eingeschlagen, die den Diskurs um Sexarbeit und Anbahnung im öffentlichen Raum maßgeblich beeinflusste. Regelmäßig wurde von dem „ausuferndem Straßenstrich“ geschrieben, der angeblich „unter Kontrolle“ gebracht werden musste. Tatsächlich waren es in den Jahren 2010/2011 nur 120 bis 180 Frauen, die auf den Straßen Wiens anbahnten – von insgesamt rund 2.500 registrierten Sexarbeiterinnen in der Stadt. Trotzdem drehte sich die Debatte, die schlussendlich zum neuen Gesetz 2011 führte, fast ausschließlich um den Straßenstrich. Dieses Gesetz hatte auch nicht, wie Frauenberger es gerne medienwirksam formulierte, das Wohl der Frauen im Sinne. Im Kern ging es vielmehr um die gesetzlich verordnete Trennung von Wohngebiet und Outdoor-Sexarbeiterinnen. Diese wurden im Prozess der Gesetzesausarbeitung, obwohl sie die direkt Betroffenen waren, in keiner Weise eingebunden – ein Vorgehen, das bei keiner anderen Berufsgruppe denkbar wäre. Letztlich führte das Gesetz auch keineswegs zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen – ganz im Gegenteil.
Das Erschaffen einer Problemsituation
Die Situation am Straßenstrich wurde vor dem Gesetzeserlass 2011 oft als beengt und prekär bezeichnet. Doch das lag nicht daran, dass zu viele Sexarbeiterinnen auf die Straßen Wiens drängten. Vielmehr war der öffentliche Raum, in dem die Anbahnung legal erfolgen konnte, in den Jahrzehnten vor der Gesetzesnovelle immer weiter eingeschränkt worden. Daher kam es trotz einer kleiner werdenden Anzahl an Outdoor-Sexarbeiterinnen zunehmend zu Platzmangel und immer lauter werdenden Anrainer_innenprotesten, allen voran der „Bürgerinitiative Felberstraße“ im 15. Wiener Gemeindebezirk. Letztere, ein kleines Grüppchen um die Wohnungseigentümerin Gabriele Schön, verstand es, Sexarbeiterinnen sowie Streetworkerinnen von Organisationen wie LEFÖ, das Leben schwer zu machen. Zudem gelang es ihr durch zahlreiche Medienauftritte und Vernetzungsarbeit Druck auf politische Entscheidungsträger_innen aufzubauen. Um die Anrainer_innen zu beruhigen – und vor allem in Hinblick auf die anstehenden Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen im Herbst 2010 – versuchte die SPÖ-Stadträtin Sandra Frauenberger mit einem sogenannten „7-Punkte-Programm“ zunächst den Straßenstrich auf zwei andere Straßenzüge im 15. Bezirk zu verlagern. Dieser Versuch scheiterte massiv, was vor allem daran lag, dass in den gesamten Ausarbeitungs- und Umsetzungsprozess keine Sexarbeiterinnen involviert wurden. Die angedachten Straßen waren für Anbahnung absolut ungeeignet und wurden entsprechend nicht angenommen.
Zugleich wurde eine Neufassung des Prostitutionsgesetzes angekündigt, welches dann relativ schnell nach den Wahlen gemeinsam mit dem neuen grünen Koalitionspartner ausgearbeitet wurde und im November 2011 in Kraft trat. Immer wieder wird betont, dass die Ausarbeitung ein langer und intensiver Prozess zwischen einer Vielzahl von Akteur_innen aus Politik, Exekutive, NGOs und „sogar“ Sexarbeiterinnen gewesen sei. Wenn jedoch der Inhalt und die praktischen Konsequenzen des WPG 2011 in den Blick genommen werden, wird schnell klar, dass die Interessen und Bedürfnisse derjenigen, die das Gesetz eigentlich betrifft, die Sexarbeiterinnen selbst, überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Die zentrale Forderung der Sexarbeiterinnen – das Aufheben der Verbotszonen für Outdoor-Sexarbeit – wurde ins Gegenteil verkehrt. Anbahnung im öffentlichen Raum wurde gänzlich aus dem Wohngebiet verbannt.
Aus den Augen, aus dem Sinn
Bereits eine Woche nach Inkrafttreten des Gesetzes waren die vormaligen Hotspots im Westen Wiens wie Felber- oder Linzerstraße wie leergefegt, was durch intensive Kontrollen und Bestrafungen seitens der Exekutive erreicht wurde. Eine neue, nicht im Wohngebiet gelegene Anbahnungszone wurde im dunklen und abgelegenen Auhof gefunden. Doch schon Mitte November nahmen die offiziellen Stellen die zuvor ausgesprochene Empfehlung zurück, da „…die Sicherheit der Frauen nicht gewährleistet werden kann“. Diese Floskel ist nicht nur angesichts des tatsächlichen Ziels des Gesetzes – Sexarbeiterinnen an den Stadtrand und in die abgelegenen Industriegebiete zu verdrängen – unglaublich dreist, sie verharmlost auch, welcher Gewalt Sexarbeiterinnen im Auhof tatsächlich ausgesetzt waren.
Auch im 2. Bezirk, traditionell ein Zentrum der Sexarbeit in Wien, wurde legale Sexarbeit schrittweise unmöglich gemacht. 2012 wurde der Prater per Erlass zur Verbotszone erklärt und 2013 das Gebiet um die neu eröffnete Wirtschaftsuniversität (WU) zum Wohngebiet umgewidmet. Das erklärte Ziel der Gesetzgeber_innen, die Zahl der Sexarbeiterinnen, die im öffentlichen Raum anbahnen – also sichtbare Sexarbeiterinnen – zu reduzieren, ist klar erreicht worden: Nur noch 15 bis 30 Frauen arbeiten Outdoor, und zwar im 21. und 23. Bezirk, ohne jegliche Infrastruktur wie öffentliche Toiletten, geschweige denn Stundenhotels in unmittelbarer Nähe. Dass Sandra Frauenberger das WPG als Erfolg für Sexarbeiterinnen verkauft, ist blanker Hohn. Auch die vielgelobte Verlagerung der Sexarbeit vom Outdoor- in den Indoor-Bereich, bedeutet keineswegs automatisch eine höhere Sicherheit für Sexarbeiterinnen. Tatsächlich werden Frauen durch eine Einschränkung ihrer möglichen Arbeitsorte in immer unsicherere und prekärere Arbeitsverhältnisse gedrängt.
Doch es darf bei diesem Thema nicht nur um (schein-)moralische Entrüstung gehen. Eine entscheidende treibende Kraft bei der Verdrängung von Sexarbeiterinnen aus dem öffentlichen Raum ist die Verwertung der Stadt, also das Ziel, den urbanen Raum Profitkriterien zu unterwerfen. Die Wiener Wirtschaftskammer (in Person von Ing. Josef Bitzinger) genauso wie die Wirtschaftsuniversität (mit dem damaligen WU-Direktor Christoph Badelt) haben sich in die Debatte um den Straßenstrich im 2 .Bezirk eingeklinkt und erfolgreich Lobbyarbeit betrieben: Stadtpolitik und Wirtschaft gaben sich gegenseitig Rückendeckung. So wie im Stuwerviertel im 2. Bezirk stiegen auch in der Felberstraße im 15. Bezirk die Immobilienwerte nach den Verboten der Outdoor-Sexarbeit sprunghaft an. Die „Säuberung“ innerstädtischer Räume von marginalisierten und stigmatisierten Gruppen ist die Kehrseite neoliberaler „Stadtaufwertung“. Dieser globale Trend hat in den letzten Jahren auch in Wien unglaublich an Bedeutung gewonnen.
Das Recht auf Stadt und öffentlichen Raum muss für alle gelten!
Öffentlicher urbaner Raum ist eine zentrale Qualität von Städten. Gleichzeitig ist er immer umkämpft: Wer hat wie Zugang zu welchen Orten in der Stadt? Welche Stadtbewohner_innen werden als willkommen anerkannt, welche sollen möglichst unsichtbar bleiben? Die Forderung nach einem „Recht auf Stadt“ bedeutet auch, ein „Recht auf Differenz“ einzufordern: Alle Menschen sollen gleiche Rechte auf den Zugang zu urbanen Räumen haben, auch wenn sie von dem abweichen, was von offiziellen Stellen als „normal“ definiert wird. Es geht dabei nicht darum, sie bloß zu „akzeptieren“ oder darum, dass sie konkrete Räume benutzen dürfen. Es bedeutet vielmehr das Recht auf den Zugang zu politischen Debatten, darauf, sich die Stadt kollektiv wiederanzueignen und gemeinsam die zukünftige Entwicklung auszuhandeln.
Damit Sexarbeiterinnen (und Sexarbeiter) eine reale Chance haben an einer solchen Debatte teilzunehmen, muss aber zuerst eine Reihe grundlegender Forderungen erfüllt werden. Dazu gehören die Einführung von Berufsrechten, die Förderung von Gewerkschaften und Selbstorganisierung, die Legalisierung des Straßenstrichs, das Abschaffen der gesetzlich verordneten Kontrolluntersuchungen, die Rücknahme der umfangreichen Polizeibefugnisse, oder auch Kampagnen zur Entstigmatisierung von Sexarbeit. Nur wenn die Position von Sexarbeiterinnen gestärkt wird und sie als Akteurinnen mit eigenen, legitimen Interessen anerkannt werden, können Sexarbeiterinnen ihr „Recht auf Stadt“ wirksam einfordern.
Franziska Wallner ist Redakteurin bei Mosaik, hat Politikwissenschaft und Geographie studiert und interessiert sich vor allem für kritische Stadtforschung und feministische Geographie.