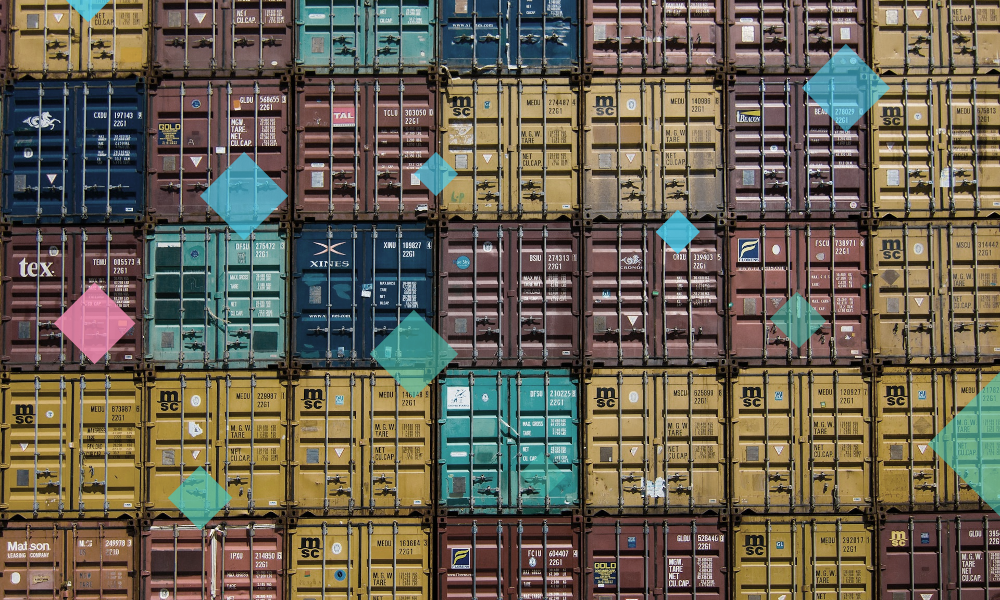Petitionen, Sicherheitschecks, Fluchthilfe – Laura Grossmann hat die LGBTQ+-Organisation „Let’s Walk Uganda” getroffen und berichtet über deren Kampf gegen das sogenannte „Anti-Homosexuellen-Gesetz”.
„Nichts ist besser für einen Mann, als eine Frau. Warum also sollten Männer andere Männer wollen?”, beginnt ein Parlamentarier seine Rede. Gelächter. „Die Menschenrechte sollen doch universell sein”, beginnt ein anderer. „Aber wenn die Mehrheit der Menschen gegen etwas ist, dann ist es doch nicht universell!” „Ich bin Vater von zwei Kindern. Wir müssen unsere Kinder schützen. Die Menschheit steht auf dem Spiel”, sagt ein dritter. Solche und weitere – ernstgemeinte – Meldungen kommen in der Liveübertragung der Parlamentssitzung als Argumente für das neue „Anti-Homosexuellen-Gesetz” vor. Das Gesetz kriminalisiert gleichgeschlechtliche Beziehungen und die Unterstützung der queeren Community. Im improvisierten Heim für von Familien verstoßene Homosexuelle sitzen fünf junge Männer gefasst vor dem Fernseher. Immer wieder entfährt ihnen ein trockenes Lachen. Sie haben nichts anderes erwartet.
Let’s Walk Uganda – die NGO
Das Heim, in dem die fünf jungen Männer leben, wird von „Let’s Walk Uganda” (LWU) geführt. Nachdem die Organisation letzten August von der Polizei gestürmt und delogiert wurde, leben die Bewohner beim geschäftsführenden Direktor Derrick zu Hause, „als Familie”, erzählt er. Die 2015 gegründete Organisation hat zwar ein neues Büro am Stadtrand; die Bewohner des Heims dort leben zu lassen, empfindet die NGO im Moment aber als zu unsicher. Das neue Büro liegt hinter einer Mauer, die Bewohner und Mitarbeiter:innen kommen niemals zu Fuß, sondern immer in Autos. So sehen die Nachbar:innen nicht, ob und wie viele Menschen aus- und eingehen. Die Nachbarschaft weiß (noch) nicht, welche Organisation das Haus mietet.
Das Büro hat eine Rezeption mit gemütlichen Sofa-Sesseln. Es stehen Banner von aktuellen und vergangenen Projekten herum. Die Projekte sind zum Großteil von ausländischen Geldern finanziert. Innerhalb Ugandas ist es fast unmöglich, Unterstützung für Aktivitäten mit oder zum Schutz von Homosexuellen zu bekommen. LWU bietet Berufsbildung an und verkauft selbstgemachte Seife an umliegende Krankenhäuser, um die Arbeit zu finanzieren und die Bewohner des Heims zu unterstützen. Wie bei der Arbeit mit anderen Minderheiten im Land geht es bei der Arbeit von LWU auch um die Vermittlung von Kompetenzen, um den Betroffenen ein wirtschaftlich selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Erneue Delogierung: Nicht ausgeschlossen
Die Organisation hält eine erneute Delogierung nicht für ausgeschlossen. Der einzige Ausweg aus dieser prekären physischen Lage wäre, Land und Haus zu besitzen, statt nur zu mieten. Vom eigenen Land könnte sie die Polizei nicht so leicht vertreiben. Auch physische Angriffe kommen vor. Um die Sicherheit der Mitarbeiter:innen zu gewährleisten, wurde vorwiegend auf Home-Office umgestellt. Einige der Außeneinsätze und physische Dienstleistungen sind aus Angst vor möglichen Razzien nicht mehr möglich.
Auch digital muss sich die Organisation schützen. Alle Dateien liegen auf verschlüsselten Servern in Deutschland. Aktuell wird regelmäßig die Website gehackt, sodass sie auf pornografische Seiten weiterleitet. Vor kurzem wurde das Bankkonto eingefroren, die Namen von Spender:innen veröffentlicht. Als einer der wenigen öffentlichen Sprecher:innen für LGBTIQ+-Rechte musste Derrick sich bereits wegen Hassnachrichten in den sozialen Medien aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Sein Sicherheitsrisiko ist gestiegen, seit die ugandische Regierung die LWU öffentlich für die Förderung von Homosexualität verantwortlich gemacht hat.
Woher kommt der Hass?
Homosexualität wird in Uganda schon lange kriminalisiert. 2014 verabschiedete die Regierung Ugandas ein Gesetz, das die Situation massiv verschärfte. Nach Druck der internationalen Gemeinschaft wurde es vom Höchstgericht gekippt: wegen Formfehlern. In den letzten Monaten ist die Homophobie im Land wieder schlimmer geworden. Zeitungen veröffentlichen hetzerische Meinungsartikel, Behörden und mittlerweile auch die Zivilbevölkerung greifen vermeintlich Homosexuelle an. Der Zugang zur medizinischen Versorgung wird ihnen verwehrt. Auf sozialen Medien werden immer wieder Mordaufrufe verbreitet und Menschen geoutet. Homosexualität wird dabei oft mit Sodomie oder mit Pädophilie gleichgesetzt; oder mit beidem.
Das Narrativ des Parlaments, das das neue Gesetz angenommen hat: Homosexualität sei eine Sünde, die aus dem Westen eingeschleppt wurde. Sie gefährde traditionelle Werte der ugandischen Kultur und Familie. Im Angesicht drohender Kürzungen von Entwicklungshilfe-Geldern müsse Uganda stark bleiben und sich dem liberalen Westen widersetzen.
Narrativ der linken Organisationen
Das Narrativ der NGO und anderer linker und emanzipatorischer Organisationen: Es ist die Homophobie, die eingeschleppt wurde – und zwar Mitte der 90er Jahre von evangelikalen Missonar:innen. Danach wurde sie mit Hilfe der Kirche verbreitet. Opportunistische Politiker:innen erkannten homophobe Tendenzen in der Bevölkerung und sprangen auf den Zug auf, um sich beliebt zu machen. Für die korrupte Regierung der populistischen, wirtschaftsliberalen Partei „National Resistance Movement” sind Homosexuelle ein praktischer Sündenbock für Missstände im Land. Gleichzeitig soll die Debatte über Homosexualität in Politik und Medien die Bevölkerung davon ablenken, dass die Regierung sie im Stich lässt.
Eduard ist ein LWU-Verbündeter, der vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen ist und derzeit Recherche für eine Masterarbeit in Nairobi, Kenia betreibt. Er befürchtet, dass der schwere Verstoß gegen die Menschenrechte durch das neue Gesetz dazu führen wird, dass Uganda einige Verträge mit Geldgeber:innen verliert. Die amerikanische Agentur für Entwicklungshilfe „USAID” hat bereits angekündigt, Gelder zu streichen. Leider verstehen viele Ugander:innen nicht, was dies für sie bedeutet, sagt Eduard.
Sichere Fluchtrouten und internationaler Druck
Seit einiger Zeit bereitet sich LWU auf die Verschärfung der rechtlichen Lage vor. Neben der Weiterführung ihrer bisherigen Projekte werden nun zwei Maßnahmen umgesetzt. Erstens soll in Nairobi ein Safe-House entstehen, in das queere Menschen aus Uganda flüchten können. Dort sollen sie dabei unterstützt werden, Asylanträge für Südafrika, Europa oder die USA zu stellen. Im benachbarten Land gibt es bereits eine große Gemeinschaft ugandischer homosexueller Geflüchteter. Für das Safe-House gibt es eine Crowdfunding-Kampagne.
Zweitens startete die NGO Petitionen an westliche Regierungen. Der einzige Weg, das Gesetz wieder zu kippen, ist den Präsidenten dazu zu bringen, es nicht zu unterzeichnen. Das passiert nur, wenn der Druck der internationalen Staatengemeinschaft groß genug ist, meint LWU. Die Petition fordert Regierungen und Institutionen dazu auf, sich öffentlich gegen das Gesetz auszusprechen. Auch eine Einreiseverweigerung für Politiker:innen, die sich für das Gesetz ausgesprochen haben, ziehen sie in Erwägung.
Eduard würde persönlich sogar weiter gehen. Er fordert auch wirtschaftliche Sanktionen gegen Uganda, obwohl diese auch die Bevölkerung treffen. Wenn möglich, sollen allerdings Förderungen für den Gesundheitsbereich aufrechterhalten werden. Wobei es leider keine Garantie dafür gibt, dass die besagten Gelder dann auch wirklich im Gesundheitssystem landen, befürchtet Eduard.
Foto: Let’s Walk Uganda, Facebook