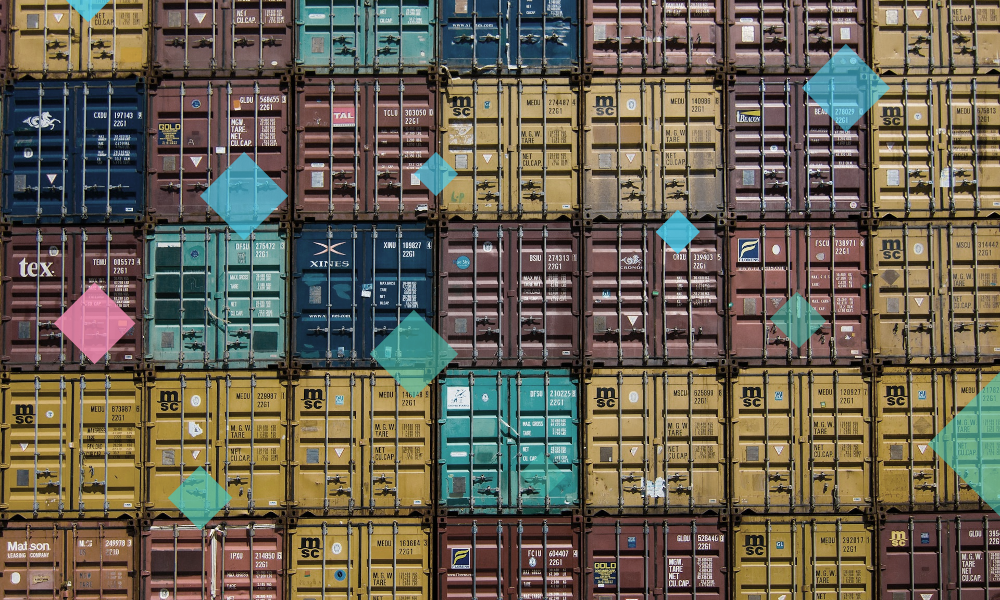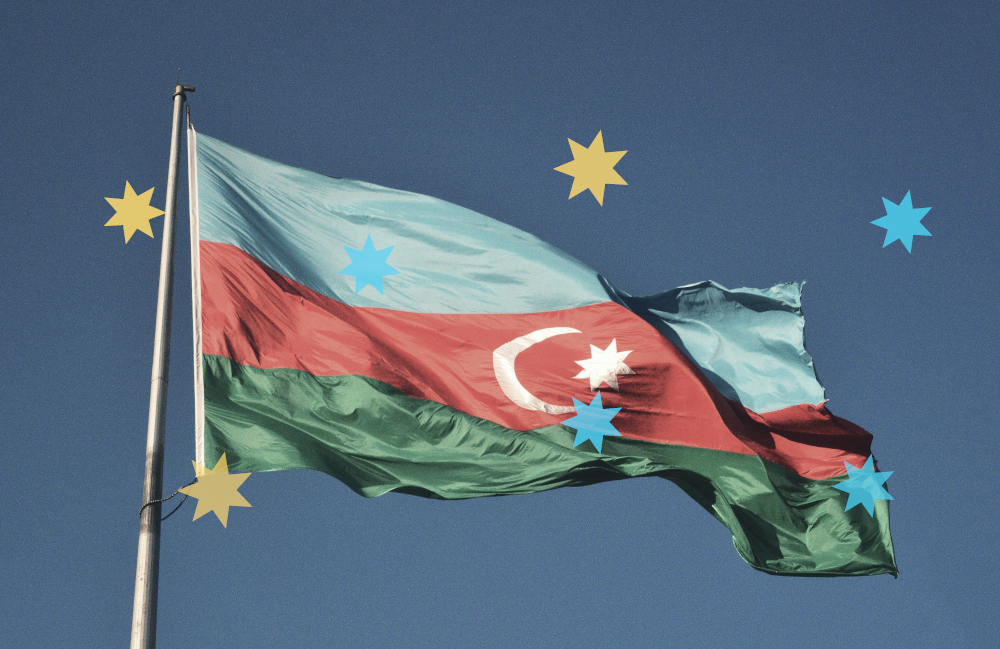Die Tropenstürme „Harvey“ und „Irma“ haben schwere Verwüstungen im Süden der USA hinterlassen. Dürfen Linke mit solchen Katastrophen Politik machen? Welche Chancen hat die Klimabewegung unter Trump? Und wie kommt die Umweltbewegung weg vom Hippie-Image? Adam Baltner sprach darüber für mosaik mit Alyssa Battistoni vom US-amerikanischen Magazin Jacobin.
Die Wissenschaft ist sich einig: Die Stürme „Harvey“ und „Irma“ sind ein Effekt des Klimawandels. Doch die US-Regierung weist derartige Aussagen mit dem Argument zurück, sie würden „eine Tragödie politisieren“. Liberale waren ihrerseits Trump vor, er würde die Katastrophe durch seine Angriffe auf WissenschafterInnen „politisieren“. Warum ist das Wort „politisieren“ sowohl für Konservative als auch für Liberale so negativ behaftet?
Einerseits versuchen die Klimawandel-LeugnerInnen in der US-Regierung, sich so ihrer politischen Verantwortung zu entziehen. Andererseits ist besonders bei Liberalen die Vorstellung verbreitet, dass in Zeiten des „Unglücks“ alle zusammenrücken und gemeinsam in einem „unpolitischen Raum“ trauern sollten. Das ist Ausdruck eines liberalen Politikverständnisses, dem zufolge es Ereignisse gibt, die außerhalb des Politischen liegen.
Etwas zu „politisieren“ wäre in dieser Logik das Gegenteil von „zusammenkommen“…
Genau. Politik wird als zynisches Spiel dargestellt, in dem es nur darum geht, Punkte auf Kosten des Gegners zu machen. Doch man kann Mitgefühl zeigen und zugleich ein Ereignis „politisieren“. Ich denke, das ist sogar notwendig: Die beste Art zu zeigen, dass einem das Schicksal der Betroffenen nicht egal ist, ist deutlich zu machen, dass ihr Unglück politische Wurzeln hat.
Politisieren heißt nicht, die Tragödie zu missbrauchen, sondern, auf die tatsächlichen politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen hinzuweisen, die sie möglich machen. Wenn es um den Klimawandel geht, ist das absolut notwendig. Es ist ja nicht so, als würde Scott Pruitt [der Chef der US-Umweltbehörde EPA, Anm.] auf einen Knopf drücken und einen Hurrikan losschicken. Die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung sind komplex. Deshalb ist es wichtig klarzumachen, dass die Effekte des Klimawandels an allen möglichen Orten und in ganz unerwarteten Formen auftauchen können.
Wie soll diese Politisierung funktionieren? Mit Trump ist ja ein offener Leugner des Klimawandels Präsident geworden. Mit Scott Pruitt hat er einen weiteren zum Chef der Umweltbehörde EPA ernannt und die USA sind aus dem Klimaschutz-Abkommen von Paris ausgetreten. Gleichzeitig sehen wir, dass auch der Widerstand wächst. Welche Auswirkungen hat der Wechsel von Obama zu Trump auf die Umweltbewegung in den USA?
Der „Trump-Effekt“ hat Menschen zu vielen verschiedenen Themen mobilisiert, weil seine Politik wirklich katastrophale Auswirkungen hat. In der Klimapolitik scheint er das komplette Gegenteil der Haltung von Obama zu verkörpern. Das lässt dessen Kurs besser erscheinen, als er war. Er hat viel über den Klimawandel geredet, aber er hat den Kampf dagegen nie ins Zentrum seiner Politik gestellt.
Obama hat beispielsweise das Klimaabkommen von Paris als großartigen Durchbruch gefeiert. Aber schon damals haben die meisten KlimaforscherInnen darauf hingewiesen, dass die Einigung weit hinter dem zurückbleibt, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Um die angestrebten Ziele zu erfüllen, sind die vereinbarten Maßnahmen schlicht nicht ausreichend – und selbst die sind nicht einmal bindend. Da es außerdem keine Sanktionsmechanismen gibt, liegt es also an den Menschen und Bewegungen in den jeweiligen Staaten, ihre Regierungen dazu zu bringen, sich an das Abkommen zu halten. Mit Trump ist diese Tatsache nur noch deutlicher zu Tage getreten.
Die Menschen können jetzt nicht mehr sagen: „Oh, wir haben ja das Klimaabkommen, damit ist das Problem erledigt.“ Stattdessen sagen sie sie: „Oh, shit! Wir müssen selbst etwas tun, um den Klimawandel zu stoppen.“ Das heißt nicht, dass das eine gute Sache ist. Aber es bedeutet, dass die Menschen wegen Trump eher dazu bereit sind, klimapolitisch aktiv zu werden. Viele AktivistInnen konzentrieren sich jetzt auf die regionale oder lokale Ebene. Da zeigen sich vielversprechende Ansätze.
Welche Ansätze sind das?
Viele Städte haben sich inzwischen auf Emissions-Obergrenzen und andere Maßnahmen zum Klimaschutz verpflichtet. Doch die Möglichkeiten auf lokaler Ebene sind beschränkt. Wir bräuchten massive Investitionen in die Infrastruktur zwischen den Städten und Bundesstaaten, die nur die Regierung aufbringen kann. Auch ein Programm für klimagerechte Jobs kann nicht auf lokaler Ebene umgesetzt werden. Letztlich brauchen wir die Macht des Staates, um die notwendigen Veränderungen durchzusetzen.
Zugleich haben wir es mit einem planetaren Problem zu tun. Das heißt, wir brauchen Maßnahmen auf globaler Ebene. Doch um ein weltweites Abkommen wie jenes von Paris durchzusetzen, fehlen die politischen Institutionen. Deshalb kommt es am Ende meist zu wirtschaftlichen Lösungen wie CO2-Steuern, weil ökonomische Institutionen auf internationaler Ebene besser entwickelt sind als politische.
Du setzt dich für eine ökosozialistische Politik gegen den Klimawandel ein, die Ökologie und Klassenfragen verbindet. Was bedeutet das, und wie kann das in der US-Gesellschaft funktionieren?
Seit den 1970er Jahren heißt es oft: Wenn du die Umwelt schützt, vernichtest du Arbeitsplätze. Manche reagieren darauf, indem sie neue, „grüne“ Jobs versprechen: Statt im Kohlebergbau soll es dann Arbeitsplätze in der Solarindustrie geben. Das ist sicher wichtig, aber die Debatte ist oft auf diese Art von traditionellen, männlichen Tätigkeiten im Bergbau oder der Industrie fixiert.
Statt uns nur auf diese relativ kleine Gruppe von ArbeiterInnen im Energiesektor zu konzentrieren, stellt eine ökosozialistische Perspektive die Frage, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen. Welche Jobs machen Menschen nur, damit sie ein Einkommen haben, und welche sind wirklich notwendig? Wie machen wir das Leben lebenswert und angenehm? Dafür sind Arbeitsplätze im „Care“-Bereich, also Pflege, Bildung, Sorgearbeit oder Erziehung, viel relevanter.
Du schreibst auch, dass wir nicht darauf warten können, bis die Linke an die Macht kommt. Sie könnte dann nur noch den ökologischen Zusammenbruch verwalten, wenn wir Klimapolitik nicht hier und jetzt ernst nehmen. Worauf sollte sich die Linke deiner Meinung nach konzentrieren?
Die wichtigsten Kämpfe der letzten Jahre richteten sich gegen den Bau neuer, großer Pipelines. Dabei geht es darum, zu verhindern, dass neue Infrastruktur für fossile Energie geschaffen wird. Diese Kämpfe werden relevant bleiben.
Daneben müssen wir aber auch eine positive Vision entwickeln. Wir müssen das Thema vom Klischee der Umweltschutz-Askese wegbringen: dass wir auf alle schönen Dinge verzichten und in Hütten leben müssen. Fragen wir uns stattdessen: Was können Elemente einer ökosozialistischen Gesellschaft sein? Wir haben über die Potenziale fortschrittlicher Stadtpolitik gesprochen. Dazu gehört der Ausbau von öffentlichem Verkehr, aber auch Wohnungspolitik. Städte mit hoher Bevölkerungsdichte ermöglichen kurze Wege. Menschen können zu Fuß oder mit dem Bus zum Arbeitsplatz gelangen und sind nicht aufs Auto angewiesen. Aber viele Menschen aus der ArbeiterInnenklasse können es sich nicht mehr leisten, in der Stadt zu wohnen. Eine Stadtpolitik, die das Recht auf Wohnen ernst nimmt, kann also auch Klimapolitik sein.
Es gibt viele Bereiche, die normalerweise nicht als Klima- oder Umweltpolitik wahrgenommen werden, aber dazu gemacht werden können. Die richtige Verbindung von Klimapolitik und der Frage der sozialen Reproduktion könnte ein wirklich starkes Programm für einen linken Kandidaten oder eine Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2020 sein. Aber bis dahin gibt es noch viele Kämpfe zu führen.
Alyssa Battistoni ist Doktorandin an der Universität Yale und Redakteurin der US-amerikanischen Zeitschrift Jacobin, dessen neueste Ausgabe „Earth, Wind and Fire“ sich der Politik des Klimawandels widmet.
Adam Baltner ist Lehrer und organisiert die Jacobin Reading Group in Wien.
Übersetzung: Benjamin Opratko