Der Terror in Wien ist über einen Monat her – doch er wirkt bis heute nach. Im Gespräch mit Mosaik unterhalten sich eine muslimische und eine jüdische Frau über ihre Erfahrungen.
Isabel macht jiddische Revolutions- und Widerstandslieder und ist politische Aktivistin. Den Terroranschlag erlebt sie über verschiedene soziale Kanäle – unter anderem den Chat der Jüdischen HochschülerInnenschaft, denn hier wird debattiert, ob es sich um einen Anschlag auf die Synagoge handelt. Naomi arbeitet als Modedesignerin und engagiert sich in einer Schwarzen Mütter-Gruppe. In der Nacht des Anschlags ruft sie erst ihren Mann, dann eine Freundin nach der anderen an, um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Hier sprechen die beiden über die Zeit nach dem Terror, Rassismus, Antisemitismus, Religion und Solidarität.
Was waren eure ersten Gedanken, als der Anschlag passierte?
Naomi: Einer der ersten Gedanken war: Oh Gott, hoffentlich ist das kein muslimischer Täter. Ich habe erst vor zehn Jahren den Islam angenommen, vor acht Jahren wurde ich sichtbare Muslima, also mit Hijab. Da hat sich die Erfahrung mit offenem antimuslimischem Rassismus schlagartig geändert. Dazu zählen auch die Erfahrungen und Gefühle, die man nach einem Anschlag hat, vor allem als Frau.
Es fühlte sich surreal an, weil Wien immer ein bisschen wie eine von der Welt abgeschottete Blase wirkt. Irgendwann kam dann Ali (Anm.: Naomis Ehemann) nach Hause und wir sind geschockt gemeinsam dagesessen. Vor allem waren wir in Sorge wegen einer Freundin, die im ersten Bezirk in einem Lokal festsaß.
Isabel: Ich hatte auch erst sehr viel Angst. Vor allem hoffte ich, dass es kein Anschlag auf die Synagoge war und andererseits, dass es kein muslimischer Attentäter war. Ich war vor fünf Jahren zufällig in Paris, als die Anschläge dort passierten. Ich hatte Angst, dass es so wie dort mehrere Anschläge an verschiedenen Orten sein könnten. Das war psychisch sehr belastend, ich hatte gleich Assoziationen mit den panischen Gefühlen von damals. Es war bei mir also auch sofort so, dass die emotionale und die politische Ebene sich vermischten. Die Sorge über die politischen Konsequenzen des Attentats war sofort da.
Was für Auswirkungen hatte der Anschlag auf euren Alltag?
Naomi: Für mich hat sich in der Zeit danach einiges geändert. Ich war am Abend nach dem Anschlag eine kurze Runde mit einer Freundin und meinem Sohn um den Block spazieren. Ich wohne in Ottakring, da fühle ich mich vor antimuslimischen Rassismus eigentlich recht sicher. Gleich als wir auf der Straße waren, fuhr uns ein Auto entgegen, das dann langsamer wurde. Darin saßen vier oder fünf Männer. Sie haben die Scheiben runter gekurbelt und uns irgendetwas zugerufen. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber das war das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist – noch dazu mit Baby. Ich habe gleich überlegt, ob ich den Kinderwagen hinter mich schieben soll und wie ich mich und meinen Sohn schützen kann. Das war schon heftig.
Ich bin dann eine Woche lang nicht alleine aus dem Haus gegangen. Und ich habe Ähnliches von Anderen gehört. Von zwei Stellen, die derlei Vorfälle dokumentieren [Zara und Dokustelle Islamfeindlichkeit & antimuslimischer Rassismus], wurden über 60 antimuslimische Übergriffe von Betroffenen selbst gemeldet. Sonst melden sich dort eher ZeugInnen. Man kann sich deshalb ausrechnen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Mein Sicherheitsgefühl war bei Null angekommen.
Die stattgefunden Razzien haben unser Sicherheitsgefühl auch nicht gerade gehoben. Mein Mann und ich reden schon darüber, inwieweit wir politisch aktiv sein sollen. Wir wollen nicht, dass bewaffnete Polizisten unseren kleinen Sohn am Bett traumatisieren. Ich versuche, nicht zu viel an mich heran zu lassen, und mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Sonst würde ich durchdrehen.

Haben sich die Vorfälle auch auf dein Sicherheitsgefühl ausgewirkt, Isabel?
Isabel: Für mich war das sehr anders. In meinem Alltagsleben hat sich nach dem Anschlag nicht wirklich etwas geändert. Ich habe gehört, dass die jüdischen Community ihre interne Sicherheit stark erhöht und Einrichtungen geschlossen oder besonders gesichert hat.
Wenn ich in wenigen Situationen Angst vor Antisemitismus habe, dann ist das eher zu speziellen Anlässen. Ich musste zum Beispiel heuer zu Yom Kippur an den Anschlag auf die Synagoge in Halle (Deutschland) letztes Jahr denken. Dazu kommt, dass ich neben der Mitgliedschaft im Stadttempel der Kultusgemeinde auch in einer kleineren Reformsynagoge Mitglied bin. Bei den Anschlägen in Pittsburgh (USA) und Halle waren auch Reformsynagogen betroffen. Da hatte ich dann schon eine gewisse Angst.
Was ich aber schon hatte, war ein starkes Unwohlgefühl, zu einem politischen Spielball gemacht zu werden. Die Situation der jüdischen Community in Wien ist dabei absurd. Obwohl wir so wenige sind, redet man gefühlt ständig über uns. Aber PolitikerInnen bekennen sich manchmal nur dann gegen Antisemitismus, wenn sie es politisch nutzen können um gegen MuslimInnen zu hetzen oder von Rechtsextremen in den eigenen Reihen ablenken wollen. Das tatsächliche alltägliche Leben von JüdInnen interessiert dabei weniger als das Reden über JüdInnen.
Seit dem Anschlag habe ich aber auch Angst vor dem wachsenden antimuslimischen Rassismus in der jüdischen Community. Der zeigt sich in Narrativen wie: „Der politische Islam ist unser größter Feind und wir müssen uns vor ihm schützen.“
Der Begriff „politischer Islam“ wurde in der Debatte nach dem Terror rege diskutiert…
Naomi: Der politische Islam: das Phantom, das niemand kennt, aber über das jeder redet [lacht]. Hier fängt schon ein riesiges Problem an. Für mich und viele MuslimInnen ist dieser Begriff zu einer Gefahr geworden. Es können jederzeit unter dem Deckmantel der Bekämpfung des politischen Islams Personen eingeschüchtert werden.
Die Erfahrung mit dem Begriff des politischen Islams musste ich selbst auch schon machen. Damals waren wir als „Netzwerk Muslimischer Zivilgesellschaft” an der Vorbereitung auf eine große antirassistische Demo beteiligt. In einer der Sitzungen wurden wir von Mit-OrganisatorInnen als AnhängerInnen des politischen Islams diffamiert und in Folge öffentlich mit allen möglichen Anschuldigungen angegriffen.
Die linke Seite reagierte zuerst mit Schweigen. Erst später gab es ein bisschen Solidarität mit einigen von uns. Wir mussten also lernen, dass sich, wenn es hart auf hart kommt, nur wenige „AntirassistInnen“ nicht von diesen politischen Schlagwörtern in die Irre treiben lassen.
Auch bei den Razzien nach dem Anschlag kam fast keine Reaktion von linker Seite.
Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Isabel: Ich finde das, was du erzählst, heftig. Außerdem ist dieser Vorwurf des „politischen Islams“ absurd. Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich sehe mich selbst auch in gewisser Weise als Anhängerin eines „politischen Judentums“. Also einerseits als dezidiert politisch-jüdische Musikerin und andererseits, dass ich im Kollektiv versuche, religiöse Bräuche umzulegen um sie auch politisch weiterzudenken. Die Tatsache, dass das natürlich nicht zur Unterstellung führt, einer terroristischen Aktivität nachzugehen, wirkt wie ein absurdes Privileg. Es ist arg, wie ungleich das behandelt wird – vom „politischen Christentum“ ganz zu schweigen [lacht]. Wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel in Polen die Kirche dazu beiträgt, das Recht auf Abtreibung anzugreifen. Wenn man schon mit diesen Begriffen um sich wirft, dann müssen doch diese Doppelstandards ins Auge springen. Wieso wird das aber nicht gesehen und thematisiert?!
Du hast auch Recht mit der fehlenden Reaktion der Linken. Erstens fand ich war ein Teil der Reaktionen inhaltlich und analytisch einfach wirklich schlecht. Obwohl unmittelbar nach dem Anschlag noch vieles unklar war, wussten wir ja zumindest, dass muslimische WienerInnen von Rassismus betroffen sind und es jetzt noch mehr sein werden. Die Solidarisierung mit MuslimInnen war in den Reaktionen aber kaum vorhanden.
Zweitens hat mich gestört, dass wegen diesen Razzien einfach nichts kam. Ich habe mir die Liste mit den Fragen angeschaut, die den Betroffenen gestellt wurden. Da werden alle möglichen Themen zusammengeworfen. Es wurden extrem persönliche und intime Gesinnungsfragen gestellt, die ich mir teils selbst stelle. Würde ich jemanden heiraten wollen der/die nicht jüdisch ist? Wie würde ich meine Kinder großziehen? Es ist krass zu sehen, wie grundlegend normalisiert antimuslimischer Rassismus quer durch die Linke, die Gesellschaft und Politik ist.
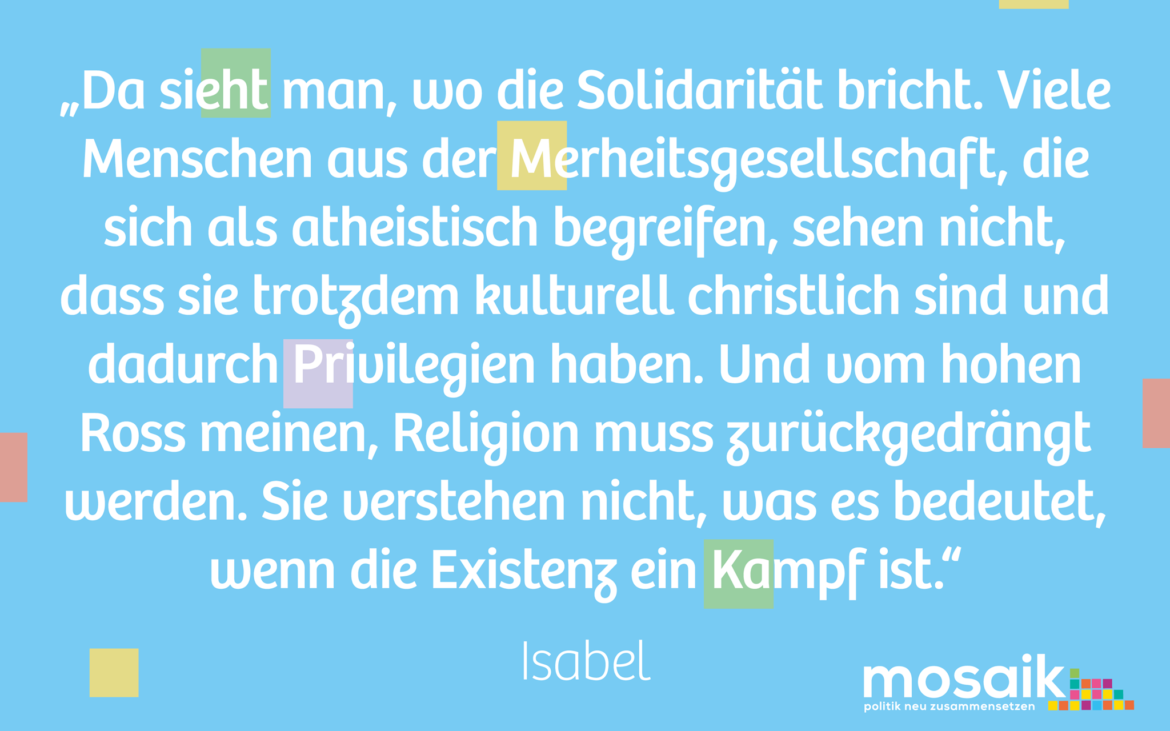
Während der Razzien soll eine Bandbreite an Fragen, vom „Glauben an die Menschenrechte“ bis zum Wissen über die „Protokolle der Weisen von Zion“ gestellt worden sein…
Naomi: Die Fragen waren absurd, aber auch ein Paradebeispiel dafür, was hier unter dem Begriff „politischer Islam“ konstruiert wird [lacht]. Schon vor Jahren haben WissenschaftlerInnen gesagt, man könne unterschiedliche Richtungen und Bewegungen mit Begriffen wie „Islamismus“ und „politischer Islam“ nicht über einen Kamm scheren. Eine Freundin, die ursprünglich aus Somalia ist, meinte einmal, wie es sein kann, dass in Europa immer von „islamistischem” Terror gesprochen wird und damit alle MuslimInnen mitgedacht werden. Dabei wird komplett ignoriert, dass der Großteil der Opfer von diesen Anschlägen eigentlich MuslimInnen sind, egal ob in Somalia, Afghanistan oder Nigeria.
Es gibt also regional unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs (politischer) Islam?
Naomi: Diese Begrifflichkeiten werden aus einer eurozentristischen Sicht verwendet. Damit entsteht das Problem, dass von „dem Islam“ gesprochen wird. Man macht hier zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt, mit verschiedensten Glaubensrichtungen, Diskursen und Traditionen, zu einem monolithischen Block. Der Begriff unterstellt, dass alle MuslimInnen die gleichen Ziele hätten. Diese Vorstellung eines homogenen Islam gegenüber einem einheitlichen Westen sehe ich bei Linken wie auch im restlichen gesellschaftlichen Diskurs. Historisch ist diese Gegenüberstellung spannend, weil sie natürlich eine koloniale Geschichte hat.
Gibt es ähnliche Problematiken mit der Definition „des Judentums”?
Isabel: Das Schreckliche an dieser Vorstellung eines einheitlichen Westens und eines einheitlichen Orients sieht man an dem Begriff des „judeo-christlichen Abendlands“. Wie stark kann ein Stockholm-Syndrom sein, wenn man sich als Holocaust-überlebende Generation auf eine „judeo-christliche Zivilisation“ beruft? Es gibt keinen Teil der Welt, in dem jüdisches Leben über Jahrhunderte mehr angegriffen wurde als im christlichen Europa.
JüdInnen wurden in den meisten westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten immer stärker als „weiß“ wahrgenommen. Damit kam auch eine gewissen Überidentifikation von JüdInnen mit dem „Westen“.
Deshalb biedern sich Menschen mit rechten Tendenzen innerhalb jüdischer Communities europäischen Rechtsextremen immer mehr an. Da haut sich Netanjahu mit Orbán auf ein Packl, obwohl dieser extrem antisemitische Kampagnen fährt. Damit hat er dann kein Problem, denn Netanjahus Sohn tweetet selbst antisemitische Sachen über George Soros. Hier findet eine gewisse internationale Rechtsradikalisierung statt.
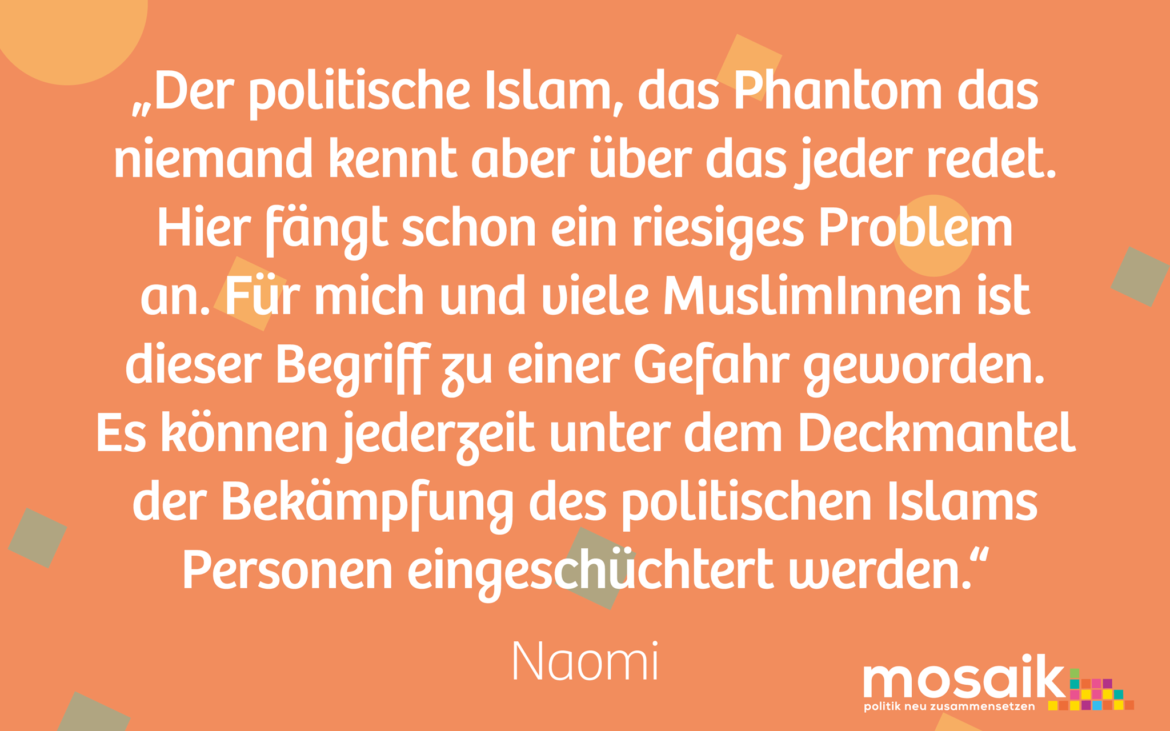
Der historische Aspekt von Antisemitismus und Kolonialismus wird ausgeblendet?
Naomi: Jedesmal, wenn ich vom „importierten Antisemitismus“ höre, denke ich mir: Schauen wir doch mal zurück was unsere Großeltern gemacht haben. Wie nehmen wir uns das Recht heraus, von einem importierten Antisemitismus zu sprechen?!
Isabel: Es stimmt natürlich, dass es Antisemitismus in muslimischen Communities gibt, genauso wie es antimuslimischen Rassismus in jüdischen Communities gibt. Aber es kam vor kurzem ein großer Antisemitismusbericht heraus. Der bekam kaum mediale Aufmerksamkeit, weil er nicht das aussagte, was sich alle gewünscht hatten. Ein Ergebnis war nämlich, dass nur ein geringer Teil von antisemitischen Vorfällen von MuslimInnen ausgeht. Das hat nicht ins Konzept gepasst.
Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus werden gegeneinander ausgespielt. Anders kann ich das mir nicht erklären. Und das, obwohl beide Formen von Rassismus sind, die zwar unterschiedlich funktionieren, aber ähnliche Mechanismen haben. Beide sind ausgrenzend, marginalisieren die Betroffenen und affirmieren gleichzeitig die Identität der RassistInnen.
Kann Religion denn unpolitisch sein?
Isabel: Unsere Religionsdefinition ist eine Illusion. Wir leben in Österreich in einer christlich-hegemonialen Kultur. Dass das nicht ausgesprochen ist, macht es gerade hegemonial.
Deshalb ist die Annahme, Religion sei etwas Privates, eine hegemoniale Idee. Natürlich ist Religion politisch. Meine persönliche Vision vom Politischen Judentum ist eine fortschrittliche. Es gibt auch reaktionäre Vorstellungen von politischem Judentum, keine Frage. Aber es ist eine Unterdrückungstaktik zu sagen, was Religion genannt wird, darf man nur möglichst leise und möglichst wenig sichtbar praktizieren.
Um das zu paraphrasieren: unpolitisch religiös zu sein, kann man sich leisten – aus einer hegemonialen Position heraus.
Isabel: Ja, genau.
Naomi: Es gibt ganz unterschiedliche Verständnisse davon, was Religion ist. Ich gehöre einer religiösen Minderheit an, die Religion und Politik zusammen denkt, wo Gerechtigkeitssinn und Solidarität zentrale Punkte sind. Religion ist nichts Separates, sondern ein ganz normaler Teil von mir und meiner Individualität.
Isabel: Da sieht man, wo die Solidarität bricht. Viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die sich als atheistisch begreifen, sehen nicht, dass sie trotzdem kulturell christlich sind und dadurch Privilegien haben. Vom hohen Ross meinen sie dann, Religion müsse zurückgedrängt werden. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, wenn die Existenz ein Kampf ist.
Es gibt so viel Pseudosolidarität. Jeder kann sich „gegen jeden Antisemitismus“ draufpicken. Aber wirklich cool damit zu sein, dass ich manchmal auch religiöse Traditionen ausübe, das sind die wenigsten Menschen.
Daran anknüpfend: Wie geht ihr in eurem politischen Aktivismus mit Zuschreibungen als Muslimin, beziehungsweise Jüdin um? Wird euch Objektivität abgesprochen?
Naomi: Das sind diese Absurditäten, wegen denen ich mich inzwischen entschlossen habe, nicht mehr in linken weißen Kreisen aktiv zu sein. Sobald du als muslimische und in meinem Fall schwarze Frau einen Raum betrittst, gibt es eine Erwartungshaltung. Wir sollen überall dabei sein, weil wir betroffen sind. Wir werden gerne hergenommen, wenn es um kurze Reden geht oder als Diversity-Maskottchen oder Quotenmensch. Man geht anders mit uns um. Angefangen mit Backgroundchecks, die es immer gibt.
Für mich war die Schlussfolgerung: Wenn ich mich ständig rechtfertigen oder von etwas distanzieren muss, mit dem ich nichts zu tun habe, dann lass ich’s einfach. Das ist verschwendete Lebenszeit.
Und dann bekomm ich oft von weißen Linken zu hören: „Wo sind denn die Muslime?“ Dabei wird ignoriert, dass schon das alltägliche Leben ein Kampf ist und du dich immer rechtfertigen musst, auch in diesen Räumen.
Das fand ich so absurd bei den Diskussionen nach dem Anschlag: Ich hab mich da kurz auf eine Diskussion rund um die beiden Burschen eingelassen, die geholfen haben. Und da kam gleich die Frage: „Feierst du jetzt Graue Wölfe?“ Das ist doch absurd. Da haben Menschen geholfen und ihr Leben riskiert.

Das waren die beiden türkischstämmigen Helfer in der Terrornacht, die danach als Anhänger der rechtsextremen „Grauen Wölfe“ kritisiert wurden.
Isabel: Ich habe auch viel über die beiden nachgedacht, die da geholfen haben. Wenn du zu einer Minderheit gehörst, wird darüber debattiert, ob du Teil der Guten oder der Schlechten bist. Das erlebe ich selbst, denn ich werde aufgrund meiner israelkritischen Haltung oft als „schlechte Jüdin” abgestempelt. Das passiert ganz schnell, teilweise auch in der Linken.
Ich habe das aber auch von anderer Seite mitbekommen. Damals bin ich das erste Mal mit meinen jiddischen Liedern aufgetreten, in einem Kollektiv in einem besetzten Haus in Amsterdam, wo ich lange aktiv war. Obwohl sie mich dort seit Jahren kannten, haben sie mich erst nach meiner Position zu Palästina gefragt. Dabei geht es mir gerade bei den jiddischen Liedern darum, nicht reduziert zu werden. Was mich am Zionismus stört, ist ja gerade auch, dass mir gesagt wird, Israel sei mein Heimatland. Was es einfach nicht ist. Meine Heimat ist Wien.
Doch auch JüdInnen mit rechtszionistischen Ansichten sind schützenswert vor Antisemitismus. Und genauso wenig tut es was zur Sache, was jemand über die Grauen Wölfe denkt, wie im Fall der beiden Helfer – das ändert nichts am Akt selber.
Naomi: Das erleben wir gerade auch bei den Razzien. Es kann doch nicht sein, dass da bei den Leuten einfach um vier Uhr in der Früh die Cobra mit Waffen steht und niemand solidarisiert sich.
Wie ist das mit Solidarität, mit wem kann und mit wem sollte man solidarisch sein – oder auch nicht?
Isabel: Ich bin seit einigen Monaten auf Twitter aktiv. Da habe ich bemerkt: wenn ich etwas zu antimuslimischen Rassismus teile, dann bekommt das viel weniger Aufmerksamkeit, als wenn ich etwas zu Antisemitismus teile.
Aber dieser selektive Anti-Rassismus ist selbst rassistisch. Sich auszusuchen, mit welchen Minderheiten man solidarisch ist, ist rassistisch. Und dass es gerade die Linke teilweise nicht schafft, eine konsequent antirassistische Haltung einzunehmen, das ist einfach unpackbar.
Naomi: Ich habe selbst schon viele Übergriffe erlebt. Letztes Jahr, da war ich schon sichtbar schwanger, hat mich eine Frau mit dem Kinderwagen aus der Straßenbahn gestoßen. Ich bin laut geworden, das mache ich in solchen Situationen immer. Und niemand hat etwas gesagt. Diese Tatsache macht mich noch viel viel wütender als die Person, die das gemacht hat. Weil ich mir denke, ich könnte da gestärkt hervorgehen, wenn nur irgendjemand solidarisch wäre.
Ich hätte eine ganz andere Einstellung, wenn ich echte Solidarität erlebt hätte. Nicht erst eine Woche später, oder wenn man sich sicher ist, dass ich keine Erdogan-Anhängerin bin.
Isabel: Was mir oft fehlt bei Solidarität, ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Position. Ein Verständnis, wie das eigene Schicksal mit dem anderen verbunden ist. Und dazu gehört auch zuzuhören und zu fragen, was man gerade konkret für die andere Person tun kann.
Solidarität würde bedeuten, anderen zu erlauben, komplexe oder nicht-formierte Meinungen zu haben. Das ist ein Grundrespekt, den es für Antirassismus braucht.
Interview: Ramin Taghian
