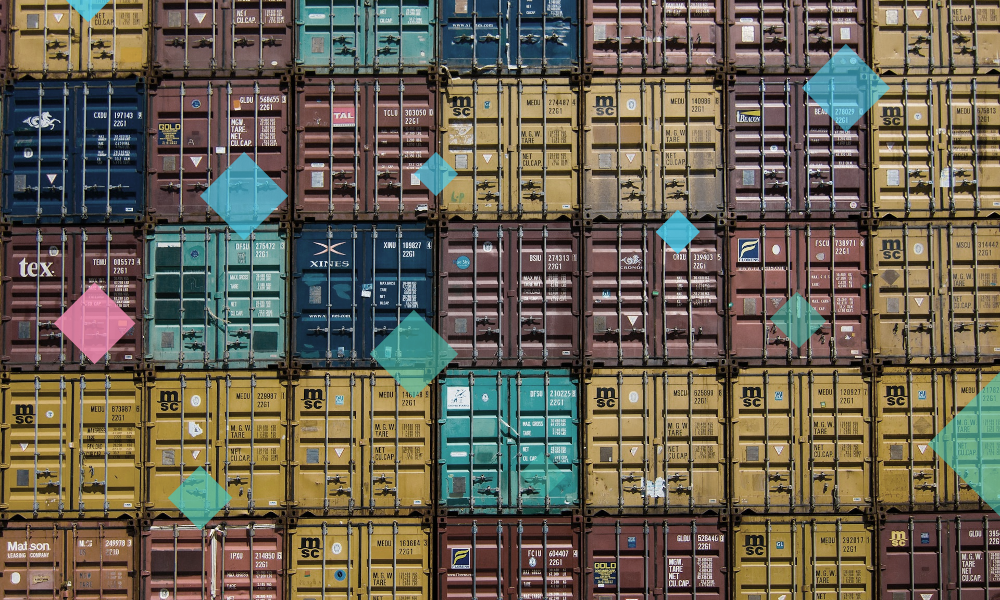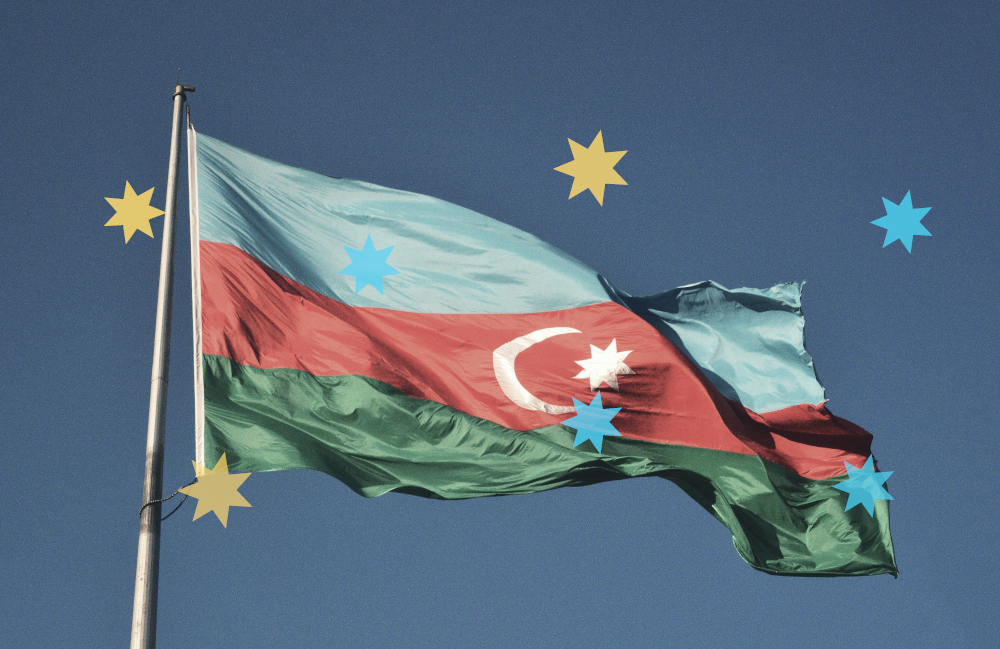Julia Salazar hat die demokratischen Vorwahlen in New Yorks 18. State Senate District gewonnen. Damit wird sie bei den Wahlen in der Nacht von heute auf morgen als erste offen sozialistische Politikerin seit fast einem Jahrhundert in den Senat des Staates New York einziehen, denn GegenkandidatIn gibt es keineN. Adam Baltner hat für mosaik mit der 27-jährigen Aktivistin gesprochen.
mosaik: Julia Salazar, herzlichen Glückwunsch! Welche Ziele verfolgst du als Sozialistin im New Yorker Senat?
Julia Salazar: Mein Wahlkreis liegt im Norden von Brooklyn. Hier leben vor allem ArbeiterInnen, das mittlere Jahreseinkommen liegt bei unter 40.000 Dollar pro Haushalt. 71 Prozent sind Schwarz oder Latinos. In den letzten 15 Jahren hat sich das Viertel durch Gentrifizierung stark verändert. Fehlende Regulierung des Wohnungsmarktes hat dazu geführt, dass viele Familien, die seit Generationen hier lebten, verdrängt wurden.
Deshalb stand leistbares Wohnen im Zentrum meiner Wahlkampagne. Das Thema betrifft Menschen in der ganzen Stadt und im gesamten Bundesstaat, aber Familien in Nord-Brooklyn sind besonders stark betroffen. Wir kämpfen für eine Mietpreisbremse im gesamten Bundesstaat New York und wollen die Deregulierung der Wohnungspolitik und damit die Verdrängung stoppen. Wir brauchen ein Mietrecht, das für die MieterInnen da ist, nicht für die Immobilienindustrie, wie es bis jetzt der Fall ist.
Für viele Menschen ist das Leben in New York einfach zu teuer. Sie können sich keine Krankenversorgung leisten, keine Kinderbetreuung oder die Pflege älterer Familienmitglieder. Deshalb wollen wir einen New York Health Act, der erstmals allen Menschen im Staat New York eine Krankenversicherung garantieren würde. Wir sind nahe dran, das zu schaffen.
Gibt es denn eine Mehrheit dafür?
Neben mir haben sich eine Reihe weiterer fortschrittlicher KandidatInnen in den Vorwahlen durchgesetzt, häufig gegen demokratische PolitikerInnen, die im Senat oft mit den Republikanern gestimmt haben. Im neuen Senat werden wir endlich eine fortschrittliche Mehrheit haben und ich stehe am linken Pol innerhalb dieser Mehrheit. Nach der Wahl werden wir dieses Gesetz also verabschieden können. Dann können alle Menschen die Pflege und Versorgung bekommen, die sie brauchen, unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer Jobsituation oder ihrem Aufenthaltsstatus.
Du hast dich in den Vorwahlen gegen Martin Dilan durchgesetzt. Er war 16 Jahre lang Senator, hat viele reicher SpenderInnen und die Führung der Demokratischen Partei hinter sich. Du bist 27 Jahre alt, bist zum ersten Mal bei einer Wahl angetreten. Wie konntest du gegen Dilan gewinnen?
Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass ich mich um einen Sitz im Senat bewerben würde, hätte ich dich ausgelacht. Ich habe als Community Organizer gearbeitet. Es waren die Leute in meiner Community, die mich dazu gedrängt haben, zu kandidieren. Ich hatte deshalb von Anfang an ein starkes Team um mich. Am Ende waren es 1.800 Freiwillige, die meine Kampagne unterstützt haben. Sie haben Wahlwerbung gemacht, an hunderttausende Türen geklopft, per Textnachrichten und Telefon mobilisiert. Sie haben mit den WählerInnen über die Themen gesprochen, die unser aller Leben betreffen. Damit haben sie einerseits die Solidarität unter NachbarInnen bestärkt, aber letztlich auch die Wahlbeteiligung im Viertel nach oben getrieben. Am Ende konnten wir die Wahlbeteiligung um mehr als 280 Prozent steigern.
Der Unterschied zwischen den beiden Kampagnen war, dass ich von einer Bewegung unterstützt wurde. Grundlage des Wahlkampagne war einerseits die New Yorker Gruppe der Democratic Socialists of America, deren Mitglied ich seit etwa zwei Jahren bin. Andererseits konnten wir auf die Arbeit zahlreicher Initiativen aufbauen, die teilweise schon seit Jahrzehnten gegen die Immobilienlobby in North Brooklyn aktiv sind. Wir haben es geschafft, ein größeres Wahlkampfbudget aufzustellen als Martin Dilan, obwohl wir keine Spenden von großen Unternehmen und der Immobilienwirtschaft angenommen haben.
Welche Erfahrungen hast du als Aktivistin in diesem Bereich gemacht, bevor du dich für die Kandidatur entschlossen hast und welche Rolle haben diese Erfahrungen für deine Kampagne gespielt?
Im Staat New York hat die Immobilienindustrie unglaublich viel Macht, vor allem, weil die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung so lasch sind. Die Immobilienlobby kann gewaltige Summen an PolitikerInnen spenden und sich so politische Macht und letztlich Gesetze kaufen. Deshalb ist der Mieterschutz in New York so schwach, deshalb können MieterInnen so leicht zwangsgeräumt werden, deshalb können ImmobilienbesitzerInnen die Mieten erhöhen wie sie wollen.
Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Bevor ich nach Brooklyn gezogen bin, lebte ich in einer Mietwohnung in Harlem. Das Gebäude wurde von einer großen Immobilienfirma verwaltet, die sich um nichts gekümmert hat. Im Winter wurde das Gebäude nicht ausreichend geheizt, dringende Reparaturen wurden nicht durchgeführt und unsere Beschwerden einfach ignoriert. Meine NachbarInnen und ich sagten damals: Es reicht! Ich war der Auffassung, dass wir unter diesen Bedingungen die Miete zurückhalten konnten, um Druck auf die Hausverwaltung aufzubauen. Wir trafen die Entscheidung, in einen Mietstreik zu treten. Schließlich kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Ich kam zur Verhandlung mit einem dicken Ordner, in dem ich alle Missstände dokumentiert hatte. Am Ende musste die Hausverwaltung die notwendigen Reparaturen durchführen und uns bei der Miete entgegenkommen.
Das war ein riesiger Sieg für meine MitstreiterInnen und mich. Ich war keine Anwältin, ich hatte damals noch keine Erfahrung in dem Bereich. Aber weil wir uns gemeinsam wehrten, konnten wir uns gegen dieses mächtige Unternehmen durchsetzen. Am Ende jedoch zwang die Hausverwaltung uns, auszuziehen. Sie verlängerten den Mietvertrag nicht und wir konnten uns nicht dagegen wehren, weil es keinen Mieterschutz gibt. Da verstand ich, dass wir neben der Organisierung von MieterInnen an der Basis auch eine Veränderung im System brauchen. Das war ein wichtiger Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, für den Senat zu kandidieren.
Wie bist du dann von einer Mietrechts-Aktivistin zu einer Sozialistin geworden?
Ich wurde Mitglied der Democratic Socialists of America (DSA), wie so viele Menschen meiner Generation in den USA, weil uns die Aufstiegsmöglichkeiten und die ökonomische Sicherheit, die uns von diesem kapitalistischen System versprochen wurden, vorenthalten werden. Ich habe 2009 die High School abgeschlossen, mitten in der Wirtschaftskrise. Am College litt ich so wie viele meiner FreundInnen unter finanziellen Problemen. Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht über unser eigenes Schicksal bestimmen können.
Meine Familie war oft in einer prekären finanziellen Situation. Meine Mutter war alleinerziehend mit mir und meinem Bruder, seit ich sieben Jahre alt war. Mit 14 Jahren begann ich neben der Schule zu arbeiten, erst in der Gastronomie, dann als Hausangestellte. Obwohl ich mich erst im College links politisiert habe, habe ich schon viel früher ein Klassenbewusstsein entwickelt. Als Erwachsene habe ich dann verstanden, dass Sozialismus meinen eigenen Interessen und meiner Weltsicht entspricht. Als Aktivistin sowohl an der Uni als auch in der Nachbarschaft habe ich erlebt, was Solidarität zwischen ArbeiterInnen und Studierenden bedeutet. Das war eine unglaublich ermächtigende Erfahrung für mich.
Als ich 22 war, begann ich, in Brooklyn Jacobin-Lesekreise zu besuchen. Dort lernte ich Menschen kennen, die nicht einfach nur Marx lesen, sondern versuchen, linke Ideen in die Praxis umsetzen und für eine demokratische, sozialistische Gesellschaft zu kämpfen. Danach habe ich in einer Wahlkampagne der Wohnrechts-Aktivistin Debbie Medina in meinem Wahlbezirk mitgearbeitet. Sie trat, so wie ich später, gegen Martin Dilan im Rennen um einen Senatssitz an und wurde dabei von den DSA unterstützt. So bin ich mit DSA in Verbindung gekommen und wurde Mitglied der Organisation.
Die Strategie der DSA ist es, in den Vorwahlen der Demokratischen Partei radikale KandidatInnen gegen das Partei-Establishment aufzustellen. Was erhofft ihr euch davon?
Viele von uns leben in Wahlbezirken, in denen die große Mehrheit der WählerInnen registrierte DemokratInnen sind. Politische Parteien funktionieren in den USA anders als in Europa. Es sind keine Mitgliederorganisationen. Für eine Partei registriert zu sein bedeutet nur, dass du bei den Vorwahlen wählen darfst. Die DSA dagegen sind eine Mitgliederorganisation, wir wollen uns selbst politisch ermächtigen. Aus strategischen Gründen kandidieren unsere Mitglieder oft bei Vorwahlen der Demokraten, denn das ermöglicht uns, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Manche meinen, wir sollten auch versuchen, die Demokratische Partei zu reformieren. Ich sehe das jedoch nicht als mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass SozialistInnen gewählt werden.
Für mich ist es am besten, wenn wir als das kandidieren können, was wir sind: SozialistInnen. An manchen Orten, etwa in Seattle, ist es durchaus möglich, als KandidatIn einer dritten Partei Erfolg zu haben – das haben wir bei Kshama Sawant gesehen. Anderswo, wie hier in New York, ist das sehr schwierig und wir müssen aus strategischen Gründen als DemokratInnen zu kandidieren.
Viele der Bewegungen und politischen Parteien, die uns in den letzten Jahren Hoffnung gegeben haben, sind stark auf eine Person konzentriert, wie Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn. Wie können deiner Erfahrung nach jüngere AktivistInnen ihr eigenes politisches Profil entwickeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte niemals kandidiert, wenn ich nicht die Unterstützung meiner lokalen DSA-Gruppe gehabt hätte und wenn ich nicht von anderen sozialistischen KandidatInnen im ganzen Land inspiriert worden wäre. Egal ob in den USA oder in anderen Ländern: Das Wichtigste ist, dass wir unsere Aktivitäten koordinieren und sie als Organisierungs-Kreislauf verstehen.
Bis Anfang dieses Jahres hatte ich nie daran gedacht, für ein politisches Amt zu kandidieren. Als ich mich dann dafür entschieden habe, konnte ich das nur, weil ich in einer Bewegung gelernt habe, politische Führung zu übernehmen und meine NachbarInnen und Community zu mobilisieren. Als SozialistInnen sollten wir überall dort, wo wir sind, aktiv sein und Menschen organisieren. Ob es eine Kampagne für leistbares Wohnen ist, politische Bildungsarbeit oder so etwas wie ein Jacobin-Lesekreis: Es geht darum, dass wir uns gegenseitig etwas beibringen.
Ich habe keinen Universitätsabschluss. Ich bin eine junge Frau und Latina. Ich bin die jüngste Person, die jemals in den Senat des Staates New York gewählt werden wird. Wir wollen jene zu Führungsfiguren machen, die üblicherweise nicht als Führungsfiguren gesehen werden. So können wir die Fähigkeiten entwickeln, die wir brauchen, wenn wir bei Wahlen kandidieren. Nicht nur, weil wir so am besten die Bewegungen repräsentieren können, sondern auch, damit wir austauschbar werden. Unsere Bewegungen sollten dadurch stärker werden, dass sie nicht auf den Schultern Einzelner liegen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mehr und mehr sozialistische Führungsfiguren haben werden, mehr als Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez oder auch mich.
Du hast, so wie auch Alexandria Ocasio-Cortez, einen Elternteil, der in die USA immigriert ist. Ihr habt beide in euren Kampagnen darauf hingewiesen, dass die Migrationsgeschichte eurer Familien eine wichtige Rolle für eure Politik spielt. In der Linken wird in letzter Zeit immer wieder über einen Gegensatz zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik gestritten. Ihr scheint ein Beispiel dafür zu sein, wie dieser scheinbare Gegensatz überwunden werden kann. Siehst du das auch so?
Wir sollten anerkennen, dass die Effekte von Klasse und von Rassismus einander überschneiden und verstärken können. Das ist gerade aus einer sozialistischen Perspektive wichtig. Rassismus war in den USA immer ein Mittel zur Durchsetzung des kapitalistischen Projekts, rassistische Diskriminierung verstärkt Klassengegensätze.
Als SozialistInnen sollten wir uns gegen rassistische Vorurteile und Diskriminierung einsetzen und zugleich darauf hinweisen, dass die Wurzeln der rassistischen Diskriminierung historisch in der Ausbeutung von ArbeiterInnen liegen. Die Wurzel von rassistischer Diskriminierung und ökonomischer Ungleichheit gleichermaßen ist der Kapitalismus. Das heißt nicht, dass Rassismus einfach verschwindet, wenn die ArbeiterInnenklasse an der Macht ist, sondern dass die ArbeiterInnenklasse an vorderster Front im Kampf gegen Diskriminierung und Ungleichheit stehen muss. Klasse und Rassismus gegeneinander auszuspielen ist eine Falle, in die wir nicht tappen sollten.