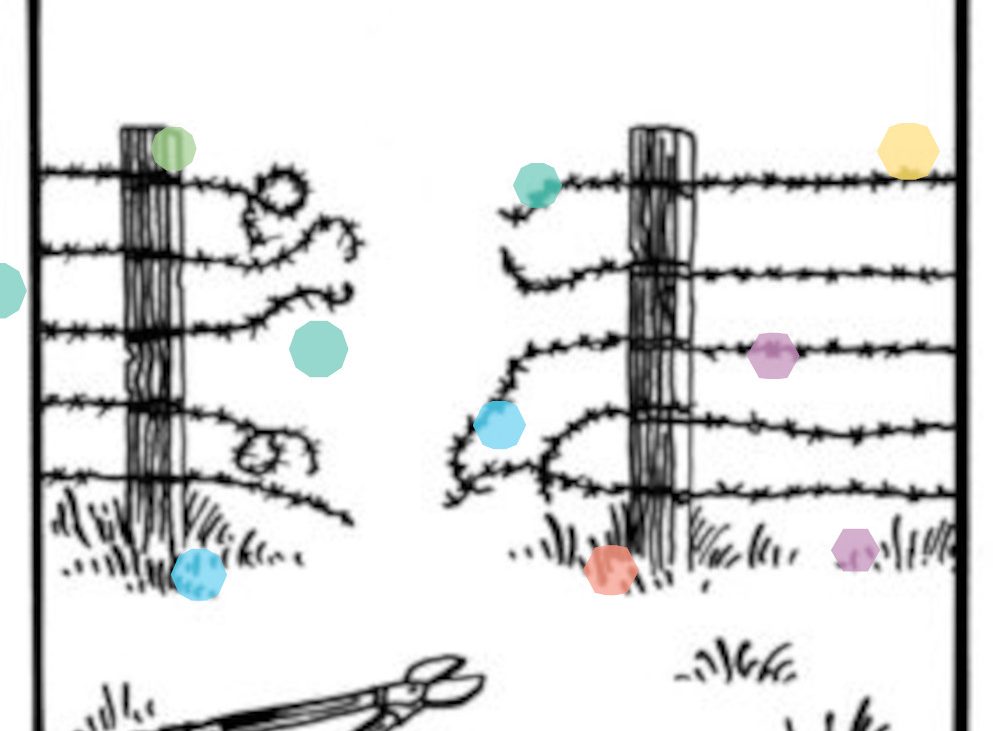Die Änderung der Mindestsicherung, wie sie die Bundesregierung in die Wege leitete, steht rechtlich auf wackligen Beinen. Denn sie orientiert sich an der Gesetzgebung in Ober- und Niederösterreich und damit an Regelungen, die der Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig erachtet. Eine Analyse von Susanna Paulweber.
Asyl in Österreich erhält, wer aufgrund der Ethnie, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt wird und sein oder ihr Heimatland verlassen muss. Der Asylstatus war immer schon als temporärer Schutz konzipiert. Verbessert sich die Lage im Herkunftsland oder fällt der Grund für die Verfolgung weg, sieht die Genfer Flüchtlingskonvention als wichtigstes internationales Vertragswerk zum Flüchtlingsschutz eine Aberkennung des Status vor. Nichts desto trotz knüpfte Österreich im Jahr 2016 den Status zusätzlich an eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsberechtigung. Personen, die nach einem bestimmten Datum in Österreich um Asyl angesucht haben, erhalten seither zusammen mit Zuerkennung des Asylstatus eine dreijährige Aufenthaltsberechtigung, sogenanntes „Asyl auf Zeit“. Ändert sich in diesen ersten drei Jahren ab Statuszuerkennung die Sicherheitslage im Herkunftsland nicht, gilt die Aufenthaltsberechtigung unbefristet.
Das Modell Oberösterreich
Der Rahmen für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, die 2010 das System der Sozialhilfe weitestgehend abgelöst hat, war ursprünglich in einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern geregelt, der sogenannten 15a-Vereinbarung, benannt nach Artikel 15a des Bundes-Verfassungsgesetzes. Als es 2015 zu einer Neuaushandlung dieser Vereinbarung kam, gab es insbesondere in den Punkten „Deckelung für große Haushalte“ und einer Wartefrist für nicht-österreichische Staatsbürger*innen keine Einigung. Dies führte zum Scheitern der Vereinbarung. Sie lief mit Ende 2016 aus. Seither sind die Länder frei, die Mindestsicherung nach ihren politischen Vorstellungen zu regeln.
Während Niederösterreich eine Wartefrist für alle Personen einführte, die sich in einem gewissen Zeitraum nicht in Österreich aufgehalten hatten, wählte Oberösterreich einen anderen Weg: Dort gibt es seit 2016 „differenzierte Leistungen“ für Personen, ohne dauerndes Aufenthaltsrecht im Inland. Insbesondere Personen mit dem Status „Asyl auf Zeit“ und subsidiär Schutzberechtigte erhalten seither lediglich eine „Basisleistung“ und nicht mehr die volle Mindestsicherung.
Das unterste soziale Netz
Die Mindestsicherung stellt das unterste soziale Netz in Österreich dar. Man* erhält sie erst, wenn keine andere staatliche Leistung, wie etwa Arbeitslosengeld, mehr in Anspruch genommen werden kann und kein Vermögen vorhanden ist.
Für Menschen mit Fluchtbiografie ist sie vor allem in den ersten Monaten nach Statuszuerkennung eine wichtige Starthilfe – müssen sie sich doch, nach ihren meist traumatisierenden Erfahrungen im Herkunftsland, in Österreich eine neue Existenz aufbauen. Da der Zugang zum Arbeitsmarkt während des Asylverfahrens, das mitunter lange dauern kann, kaum möglich ist, ist die Existenzsicherung durch die Mindestsicherung in den ersten Monaten nach Asylzuerkennung von großer Bedeutung. Denn nur, wenn ausreichend Geld zum Leben vorhanden ist, kann man* sich beispielsweise dem Erlernen der Sprache widmen.
Europäisches Urteil
Österreich ist durch Unionsrecht, konkret durch die sogenannte Statusrichtlinie, zur Einhaltung gewisser Mindeststandards verpflichtet. So müssen Flüchtlingen auch Sozialhilfe unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörigen bekommen. Aufgrund zahlreicher Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich entschied sich dieses im Dezember 2017 dazu, die Frage der Vereinbarkeit der oberösterreichischen Regelung mit der Statusrichtlinie dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorzulegen.
Dieser kam Mitte November zu dem Schluss, dass die geringere Mindestsicherung für Personen mit „Asyl auf Zeit“ mit Unionsrecht unvereinbar ist. Der EuGH kann – anders als der Verfassungsgerichtshof – inländische Gesetze nicht aufheben, oder „kippen“, wie zuletzt mehrfach zu lesen war. Der EuGH befasst sich lediglich mit der Frage, ob eine nationale Regelung mit Unionsrecht vereinbar ist oder diesem entgegensteht.
Die Pläne der Bundesregierung
In Bezug auf das geplante Grundsatzgesetz des Bundes zur Mindestsicherung, mit dem den Ländern ein einheitlicher Rahmen vorgegeben werden soll, zeigt das EuGH-Urteil der Regierung einmal mehr Grenzen auf: Dienten die Modelle in Nieder- und Oberösterreich zunächst noch als Vorbild für das Grundsatzgesetz zur Mindestsicherung, erweist sich nun auch die oberösterreichische Regelung zum Teil als rechtswidrig. Asylberechtigte, egal ob sie über ein befristetes oder unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügen, steht die Gleichbehandlung mit Staatsbürger*innen zu.
Ob der geplante „Arbeitsqualifizierungsbonus“, also die Koppelung der vollen Leistung an den Pflichtschulabschluss bzw. sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse, einer Überprüfung durch die Höchstgerichte standhalten wird, wird sich weisen. Diese Regelung diskriminiert Asylberechtigte zwar nicht offen – der „Bonus“ gilt ja offiziell nicht nur für diese – eine mittelbare Diskriminierung gibt es dennoch. Vor allem Flüchtlinge, die während des Asylverfahrens nicht überall und nicht in ausreichendem Maß Zugang zu Deutschkursen haben, werden das geforderte Sprachniveau nicht erreichen können.
Subsidiärer Schutz
Für subsidiär Schutzberechtigte, die ihr Heimatland ebenfalls wegen einer Gefahr für Leib oder Leben verlassen mussten, hat das Urteil entgegen einiger Berichte keine derart konkreten Auswirkungen. Denn der EuGH hat in der Entscheidung zu Oberösterreich einmal mehr betont, dass Personen mit diesem Status sehr wohl nur „Kernleistungen“ gewährt werden dürfen. Das gilt allerdings nur, solange eigene Staatsangehörige sie im gleichen Umfang und unter denselben Voraussetzungen erhalten.
Um diese Gleichbehandlung mit Staatsbürger*innen im neuen Gesetz zu gewährleisten, hat sich die Bundesregierung Folgendes einfallen lassen: Subsidiär Schutzberechtigte sollen künftig ausschließlich Leistungen in Höhe der Grundversorgung erhalten, wie dies auch jetzt schon in einigen Bundesländern der Fall ist. Um die Inländer*innengleichbehandlung nach Unionsrecht einzuhalten, sollen laut Entwurf zum neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz auch bestimmte verurteilte Straftäter*innen nur mehr Leistungen in Höhe der Grundversorgung erhalten, zumindest für die Dauer ihrer (bedingt nachgesehenen) Freiheitsstrafe.
Auch diese Konstruktion steht allerdings im Widerspruch zu Unionsrecht. Die Grundversorgung ist nämlich nur für hilfsbedürftige Fremde – und eben nicht auch für Österreicher*innen – vorgesehen. Zudem erfüllt sie die von Statusrichtlinie vorgeschriebene Gleichstellung nicht. Sie gewährt die Leistungen eben nicht „unter gleichen Voraussetzungen“. Während Inländer*innen nur bei einer Verurteilung weniger bekommen sollen, sollen subsidiär Schutzberechtigte nur wegen ihres Status aus der Mindestsicherung ausgeschlossen werden. Von der Stigmatisierung geflüchteter Menschen durch Gleichsetzung mit verurteilten Straftäter*innen einmal abgesehen, steht dieser Regelung erneut das Unionsrecht entgegen und der Gesetzesentwurf zur „Mindestsicherung Neu“ damit, wie die beiden Vorbilder Nieder- und Oberösterreich zeigten, auf rechtlich wackeligen Beinen.
Susanna Paulweber ist Juristin. Sie engagiert sich unter Anderem für die plattform asyl.