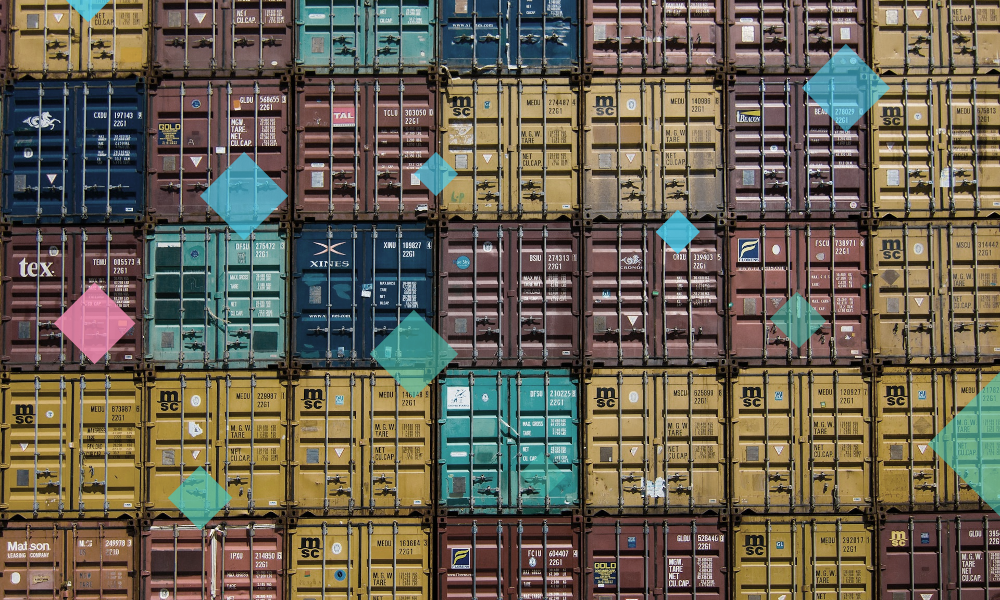Der US-Wahlkampf geht in die allerletzten Züge und die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump medial sehr präsent. Über die bestehenden sozialen Kämpfe in den USA wird aber kaum geschrieben. Schon seit 2012 kämpft die Kampagne „Fight for 15“ in den USA für einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn. Sie fordern 15 Dollar – rund 13,10 Euro – pro Stunde und das Recht sich im Betrieb gewerkschaftlich zu organisieren. Vorläufiger Höhepunkt war im vergangen April, als im Rahmen von „Fight For 15“ zehntausende Arbeitnehmer_innen in über 150 Städten die Arbeit niederlegten.
Begonnen hat alles sehr klein. 2012 haben Fast-Food-Angestellte zum ersten Mal unter dem Slogan „Fight for 15“ ihre Arbeit niedergelegt, zunächst in New York, doch die Kampagne weitete sich rasch auf die ganzen USA aus. Darüber hinaus schlossen sich auch andere Berufsgruppen der Kampagne an: Flughafenangestellte, Supermarktangestellte, Kindergartenpädagog_innen, Pflegepersonal, Uniassistent_innen und Lehrer_innen griffen die Forderung nach der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde auf. Gemeinsame Botschaft der Kampagne: Von den seit Jahren stagnierenden Mindestlöhnen lässt sich am Ende des Monats schlicht und einfach nicht mehr leben.
42 Prozent der Arbeitnehmer_innen in den USA verdienen weniger als 15 Dollar pro Stunde (Stand Ende 2015). Darunter befinden sich überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer_innen über 35 Jahren, Frauen und schwarze Arbeitnehmer_innen.
Spezifische Hintergründe und Voraussetzungen in den USA
Im Gegensatz zu Österreich müssen in den USA mehr als die Hälfte der Angestellten eines Betriebes in einer Urabstimmung zustimmen, damit eine Gewerkschaft offiziell aktiv werden darf. Erst dann darf sie Löhne und Arbeitsbedingungen verhandeln. In der Fast-Food-Branche sind lokale Standorte großer Fast-Food-Ketten via Franchising formal eigenständige Betriebe. Angestellte von McDonald’s oder Burger King müssen daher in jedem einzelnen Standort in einer Urabstimmung für gewerkschaftliche Vertretung stimmen, um dort legal aktiv werden zu können. Aus diesem Grund ist eine der beiden zentralen Forderungen von „Fight for 15“, in allen Filialen einer Kette gewerkschaftlich anerkannt zu werden. Da Veränderungen über die betriebliche Ebene unter den gegebenen Bedingungen einem Hindernislauf gleichkommen, zielte die Kampagne nicht auf die einzelnen Arbeitgeber_innen der vielen Standorte oder die großen Fast-Food-Ketten ab. Stattdessen entschied sie sich dafür, politischen Druck auszuüben und über die Anhebung des Mindestlohns höhere Löhne in ganzen Branchen durchzusetzen.
Denn im Gegensatz zu Österreich gibt es in den USA gesetzliche Mindestlöhne. In Österreich werden Mindestlöhne in Kollektivverträgen zwischen den Sozialpartnern jeder Branche festgelegt. In den USA wird der gesetzliche Mindestlohn auf mehreren Ebenen geregelt: auf Gemeindeebene, in den einzelnen Bundesstaaten und schlussendlich als minimale Grenze auf Bundesebene (seit 2009 7,25 Dollar pro Stunde).
Zwischen Gewerkschaft und Bewegung
„Fight for 15“ versucht sich aber auch auf andere soziale Bewegungen wie „Black Lives Matter“, die Bewegung gegen rassistische Gewalt und strukturellen Rassismus, aktiv zu beziehen und gemeinsame Aktionen zu koordinieren. Damit ist „Fight for 15“ heute weit mehr umfassende Bewegung für soziale Gerechtigkeit, als eine bloße Kampagne von Fast-Food-Angestellten. Voraussetzung dafür ist wohl die langjährige Erfahrung mit Organisierungskampagnen von US-Gewerkschaften, wie der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU, andererseits aber auch die Erfahrungen vieler Aktivist_innen um Grenzen der Occupy-Proteste 2011.
„Fight for 15“ setzte daher von Anfang an auf möglichst niederschwellige Beteiligungsmöglichkeiten an der Kampagne. Via Website können sich Arbeitnehmer_innen melden und von ihren Arbeitsbedingungen berichten. Zugleich werden gezielt Multiplikator_innen gesucht, die sich zutrauen mit Unterstützung von Aktivist_innen der Kampagne einen kleinen Warnstreik am Arbeitsplatz zu organisieren. Symbolisch werden in einzelnen Städten immer wieder einzelne Filialen großer Konzernketten blockiert und geschlossen oder auch wichtige Straßen besetzt. Begleitet wurden diese Schritte bald von immer größer werdenden Mobilisierungen, um lokale Politiker_innen vor allem im Wahlkampf gezielt unter Druck zu setzen.
Rasche Erfolge der Kampagne im US-Wahlkampf
Der ständig steigende Druck durch „Fight for 15“ zeigte bald erste Erfolge: Mittlerweile haben die beiden wichtigsten US-Bundesstaaten New York und Kalifornien erklärt, den Mindestlohn bis spätestens 2022 auf 15 Dollar pro Stunde anzuheben. Aber auch viele traditionell regulierungs- und gewerkschaftsfeindliche Bundesstaaten sehen sich unter dem immer größeren Druck genötigt, die zumeist extrem niedrigen Mindestlöhne anzuheben.
Zum anderen schaffte es „Fight for 15“ den US-Vorwahlkampf maßgeblich zu beeinflussen und so die eigenen Forderungen auf nationale bzw. bundesweite Agenda zu setzen. Auf Seiten der Republikaner konnten sich immerhin zwei Kandidaten vorstellen den Mindestlohn auf Bundesebene anzuheben. Bei den Demokraten stand Bernie Sanders von Anfang an hinter den Forderungen der Kampagne. Der unerwartete Erfolg von Sanders ist nicht zuletzt auf die vorangegangene Mobilisierung von unten im Rahmen von „Fight for 15“ zu erklären. Durch seine Unterstützung wurde schließlich auch Hillary Clinton im Zuge des Vorwahlkampfs dazu gezwungen, die grundsätzliche Forderungen nach 15 Dollar pro Stunde auf Bundesebene zu übernehmen. Mittlerweile ist die Forderungen überhaupt Teil der offiziellen Position der Demokraten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Noch 2015 wollte das demokratische Partei-Establishment rund um Hillary Clinton den Mindestlohn auf maximal 12 Dollar anheben. Und noch wenige Jahre zuvor war die Anhebung des Mindestlohns unter den Demokraten gar kein Thema, Diskussionen wurden in der Partei stillgelegt.
Was lässt sich aus der Kampagne lernen?
Trotz der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen lässt sich von „Fight for 15“ als Mobilisierungskampagne mit einigen Organisierungselementen viel lernen. Kampagnenorientierte Politik versucht mit den eigenen, begrenzten Ressourcen adäquat umzugehen. Als Konsequenz daraus sollen wenige, messbare Ziele in einem definierten Zeitraum erreicht werden. Der Erfolg von „Fight for 15“ liegt dementsprechend in einer klugen strategischen Ausrichtung der Kampagne. Da wäre erstens die Zuspitzung auf ein klar benennbares und messbares Ziel, das Menschen trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten verbindet; zweitens das Aufgreifen und inhaltliche Besetzen eines „Lückenthemas“, das andere politische Akteur_innen (die beiden großen Parteien) meiden; und nicht zuletzt die Entscheidung „über die Bande zu spielen“ und Druck auf politischer Ebene in Wahlkampfzeiten aufzubauen, statt sich in erster Linie auf Konzerne und deren Machenschaften einzuschießen.
Es gibt viele gute Argumente, die dafür sprechen, auch in Österreich als Linke einen gesetzlichen Mindestlohn auf die politische Tagesordnung zu setzen. Gewerkschaften berufen sich hierzulande zwar darauf, dass es eine hohe Deckung an Kollektivverträgen besteht. Die unbereinigte Deckungsrate – ohne öffentlich Bedienstete und ohne geringfügig Beschäftigte – lag 2009 etwa bei 76,2 Prozent. Die Kollektivverträge regulieren Löhne und würden durch einen gesetzlichen Mindestlohn unter Druck geraten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei der Einführung des Mindestlohns in Deutschland, wo Gewerkschaften lange ähnlich argumentiert haben, sollte in der Diskussion jedoch mehr differenziert werden. Tatsächlich sind die kollektivvertraglichen Mindestlöhne in Österreich in einigen Branchen extrem niedrig. So beginnen beispielsweise Friseur_innen bei rund 6,5 Euro pro Stunde bzw. monatlich 1.137 Euro brutto (ohne Sonderzahlungen).
Aus einer kampagnenorientierten Perspektive würde sich die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn hierzulande für ein linkes Projekt von unten eignen, da das Thema von anderen politischen Akteur_innen wenig besetzt ist und ein klar zu definierendes Ziel (zum Beispiel 13 Euro pro Stunde) vorgibt. Allianzen mit vielfältigen politischen Akteur_innen würden im Sinne eines Mosaiks der gesellschaftlichen Linken – aber auch jenseits dieser – auf der Hand liegen. Auch in tagespolitische Debatten (Stichwort „Deckelung der Mindestsicherung“) ließe sich so zielgerichtet intervenieren. Vor allem aber hätte das Thema das Potenzial Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten und damit verbunden Problemen anzusprechen und zusammenzubringen. Nicht zuletzt beträfe das Thema aber auch viele „von uns selbst“.
Rainer Hackauf ist basisgewerkschaftlich und antirassistisch aktiv. Er ist Mitglied im Verband zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender. Rainer bloggt unter www.si-se-puede.at über Organisierungs- und Kampagnenarbeit.