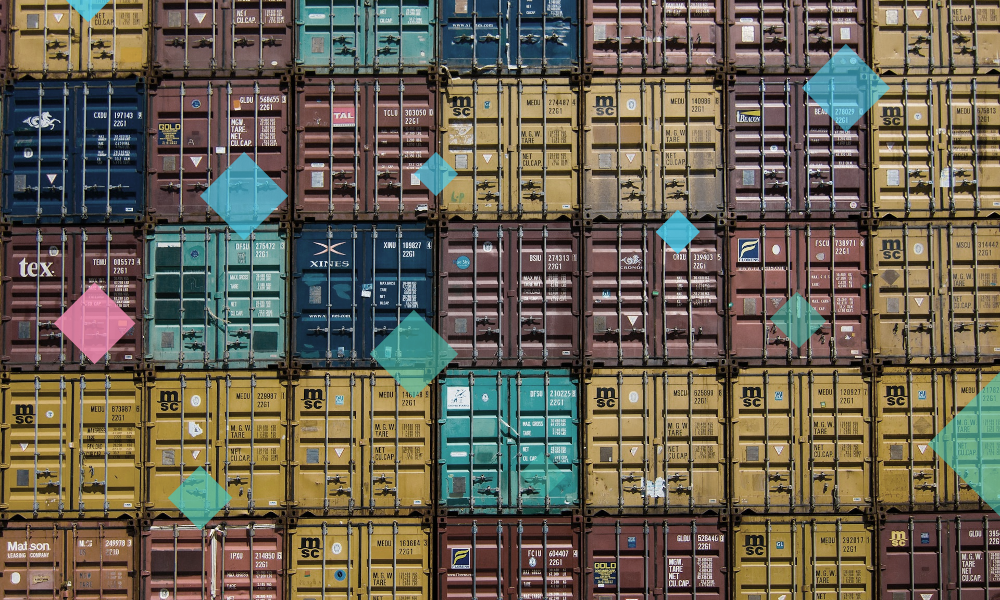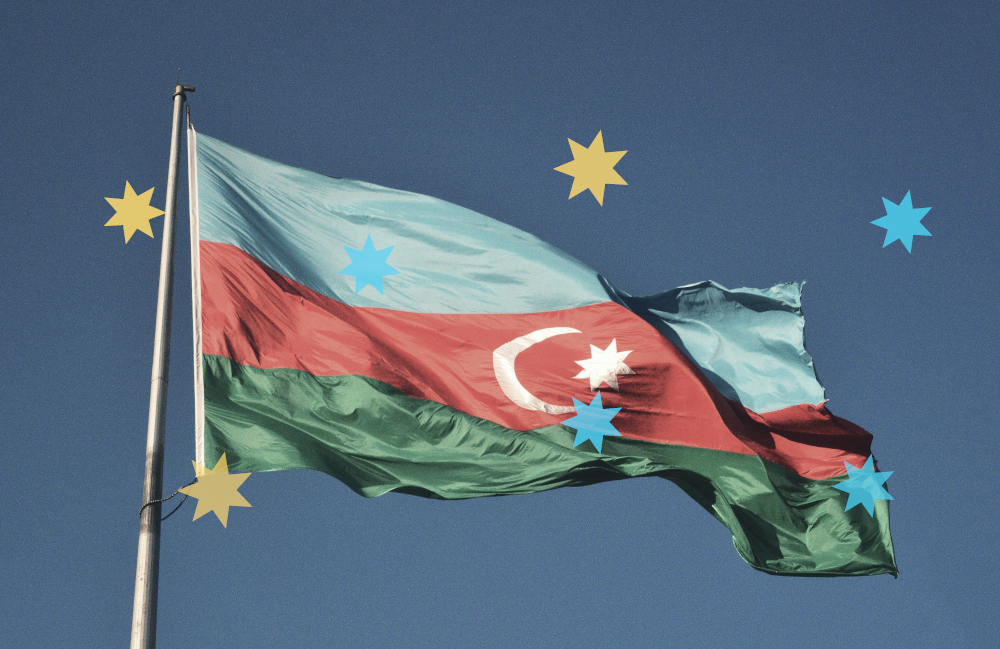Mit einem Austritt lassen sich die Probleme von EU und Euro nicht lösen, meint Kurt Bayer. Stattdessen sollten wir für eine andere Union kämpfen, argumentiert er im zweiten Teil unserer EU-Debatte.
Das Plädoyer von Cristina Asensi für einen Lexit, also einen „linken“ Exit aus Euro und Europäischer Union (EU), geht von deren Unreformierbarkeit aus. Was noch wichtiger ist: Asensi scheint anzunehmen, dass EU, Eurozone und Europäische Zentralbank (EZB) vollkommen eigenständige und unabhängige Institutionen sind, die niemandem Rechenschaft schulden.
Nicht genetisch neoliberal
Warum das wichtig ist? Weil nur dann ihre Argumentation, dass EU, Eurozone und EZB quasi genetisch neoliberal sind, stimmt. Nur dann könnte ein Lexit die Lage für die leidenden Bevölkerungen verbessern. Aber auch das wäre nur dann der Fall, wenn nach einem EU-Austritt oder einer Auflösung der EU-Institutionen die Bevölkerungen ihre je eigenen Regierungen dazu bringen, das neoliberale Dogma auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen.
Die Wahrheit ist jedoch komplizierter. Die EU-Politik, die Politik der Eurozone und jene der EZB werden von den RepräsentantInnen der Mitgliedsländer gestaltet und dominiert. Verantwortlich sind also RegierungschefInnen, MinisterInnen und Notenbank-GouverneurInnen. Der EU-Rat und der Gouverneursrat der EZB setzen die Leitlinien der Wirtschaftspolitik fest. Sie folgen dabei zwar oft Vorschlägen der EU-Kommission, manchmal wirkt auch das EU-Parlament mit, aber die entscheidende Rolle spielen auf nationaler Ebene gewählte bzw. bestimmte Personen.
Nationale PolitikerInnen sind verantwortlich
Natürlich stimme ich Asensi zu, dass es viel mehr Partizipation, viel mehr Mitwirkung des EU-Parlaments und der Zivilgesellschaft braucht. Und natürlich sind die Verträge von Maastricht und Lissabon nicht das Gelbe vom Ei, was Mitwirkungsrechte angeht. Aber: Die fehlenden Teilhabemöglichkeiten gehen auf die Staats- und RegierungschefInnen zurück, die diese Verträge abgesegnet haben. Die verantwortlichen PolitikerInnen lassen in ihren Ländern genauso wenig tatsächliche Partizipation zu. Auch dort sehen sie die Bevölkerung eher als Stimmvieh, denn als notwendigen Teil einer gelebten Demokratie an.
Daher lehne ich die Illusion der Lexit-BefürworterInnen, dass nach einem Austritt oder einer Auflösung alles besser werde, ab. War denn vor der Gründung der EU oder den Maastricht- und Lissabon-Verträgen so vieles besser? Natürlich, seit der Krise 2008 verschlechtert sich die Lebenssituation vieler Menschen massiv. Doch wer ist dafür verantwortlich? Die EU, die Eurozone oder die Europäische Zentralbank, die immerhin als einzige wirksame EU-Institution versucht hat, der Krise gegenzusteuern? Sind es nicht viel eher die neoliberalen FinanzministerInnen, RegierungschefInnen und GouverneurInnen, die für diese verfehlte Politik verantwortlich sind?
Schwächere EU wäre fatal
Ich sehe in einer weiteren Schwächung der EU nicht nur ein fatales wirtschaftspolitisches Signal, sondern auch noch einen gewaltigen Rückschritt politischen Ausmaßes. Ohne die ewige Leier von der „Friedensunion“ zu schlagen, bin ich der Meinung, dass die teilweise Überwindung des Nationalstaats ein riesiger Fortschritt ist. Wir alle sollten nicht Lexit-Illusionen nachhängen, sondern dafür kämpfen, dass die EU eine Wirtschafts- und Sozialpolitik im Sinne der Bevölkerungen macht, statt im Interesse der Finanzkonglomerate und der Großunternehmen.
Im Einzelstaat geht wenig
Die zersplitterte Linke sollte sich auf die Erarbeitung von Wirtschaftsmodellen konzentrieren, breit diskutieren und sich dann für ihre Umsetzung stark machen. Auf internationaler Ebene kann dieser Plan besser als auf einzelstaatlicher Ebene gelingen. Gewerkschaften dürfen sich beim Kampf um mehr und bessere Arbeitsplätze nicht gegeneinander ausspielen lassen. Sie müssen über nationale Grenzen hinweg solidarisch handeln und gemeinsam Gewinnverschiebungen in Steueroasen und Briefkastenfirmen verhindern.
Es liegt an Gewerkschaften, extrem hohe Gehälter der UnternehmensführerInnen zu bekämpfen und sich für gute Arbeitsbedingungen sowie langfristige Nachhaltigkeit stark zu machen. Die Finanzindustrie wieder zur Dienstleisterin an der Gesellschaft machen, statt sich von den „Märkten“ und „Investoren“ dominieren zu lassen, muss eine der zentralen Lektionen aus der Vergangenheit, vor allem aus der Krise, sein.
Keine Hoffnung auf Eliten
Viele hatten gehofft, dass das unselige Brexit-Votum die RegierungschefInnen und die Kommission aufrütteln würde. Leider scheint auch diese Hoffnung nicht aufzugehen. Sie sehen nicht ein, dass die bisherige EU-Politik falsch war und dass die Bevölkerungen diese Politik nicht mehr mittragen wollen. Auf die Einsicht der Kommission, der StaatschefInnen und der EZB-GouverneurInnen zu hoffen, ist falsch. Jede und jeder Linke sollte wissen: Im bestehenden System haben es sich viele gut eingerichtet, haben materiell profitiert und politische Macht („Wir sind die Herren der Welt“) erworben. Diese Privilegien werden nicht durch Einsicht aufgegeben, sondern müssen durch harten Kampf beseitigt werden.
Tiefe Gräben stehen zwischen den Interessen der arbeitenden Bevölkerungen, der Umwelt, der sozialen Inklusion auf der einen Seite und jenen der dominierenden Finanz- und Realunternehmen und ihrer politischen VertreterInnen auf der anderen Seite. Sozialdemokratische und sozialpartnerschaftliche Versuche, diese Widersprüche durch „sublimierten Klassenkampf“ (Bruno Kreisky) aufzulösen, sind spätestens seit der Krise gescheitert. Jetzt muss die Bevölkerung, unter Führung der Linken, ein soziales, humanes, ökologisches und wirtschaftlich erfolgreiches Europa erkämpfen.
Für eine bessere EU kämpfen
Bevor es soweit ist, muss die intellektuelle Linke noch viel Vorarbeit leisten sowie Zukunftsvisionen und Strategien entwickeln, wie ein „besseres“ System in Europa aussehen kann. Das Ziel, die EU aufzulösen oder aus ihr auszutreten, erübrigt sich, wenn eine bessere EU in Aussicht steht. Ihre Ideologie kann dann nicht länger „Standortwettbewerb“ heißen oder, ehrlicher formuliert, „die Großen fressen die Kleinen und die Armen sollen bleiben wo sie sind“.
Beginnen wir damit, die Fehler bei den einzelnen Schritten der EU-Entwicklung aus Sicht der arbeitenden Bevölkerungen zu identifizieren und, darauf aufbauend, die EU umzubauen. Welche Rolle die Eurozone und die EZB dabei spielen werden und in wessen Interesse Politik dann umgesetzt wird, entscheiden wir. Die Lösung kann jedenfalls nicht Rückschritt zum Nationalstaat lauten.
Kurt Bayer ist Ökonom und Jurist. Er arbeitete für das WIFO, das Finanzministerium, die Weltbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Seinen Blog findet ihr hier.
Teil 1 unserer EU-Debatte, in dem Cristina Asensi für einen Lexit argumentierte, könnt ihr hier nachlesen. Etienne Schneiders hat hier auf beide Beiträge reagiert.