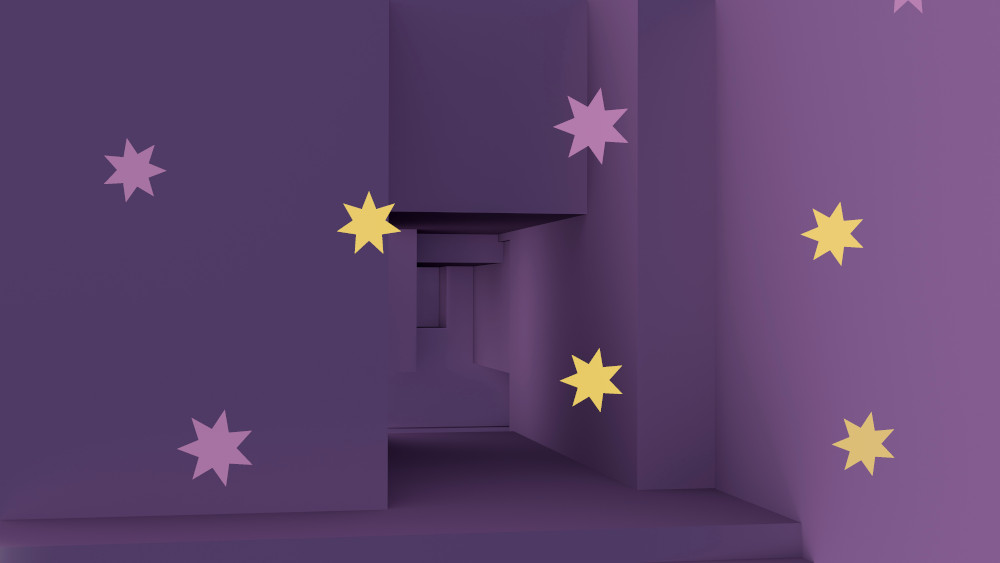In verteilungspolitischen Fragen hat die Linke Fakten und logische Argumente auf ihrer Seite. Um breitere Unterstützung zu finden, muss sie aber auch Zustimmung auf der Ebene von Gerechtigkeits- und Moralvorstellungen finden. Dafür hilft es, konservative Hausverstandsvorstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit zu verstehen und öffentlich überzeugend zu kritisieren.
Seit einiger Zeit wird in Österreich wieder eine öffentliche Debatte zu ökonomischen Verteilungsfragen geführt. Die Positionen sind einzementiert, die Chancen auf eine substantielle Reform des Steuersystems die auch Vermögens und Erbschaftssteuern inkludiert scheinen gering. In dieser Debatte hat die Linke Fakten und logische Argumente auf ihrer Seite. Hohe und steigende Vermögens- und Einkommensungleichheit sowie geringe soziale Mobilität zwischen den Generationen lassen sich schwer leugnen. Außerdem wissen wir, dass die Mittel zur Umverteilung – wenn eine solche gewünscht ist – existieren. Wenn wir wollen, können wir die Chancen derer, die wenig haben, verbessern; um den Preis, dass die, die viel haben, etwas weniger bekommen. Und wir wissen auch, dass – wenn so eine Umverteilung gewünscht ist – Vermögens- und Erbschaftssteuern, neben progressiven Einkommenssteuern, zu einem sinnvollen Mix steuerpolitischer Instrumente gehören.
Das alles ist richtig und wichtig und sollte in der öffentlichen Diskussion betont werden. Und dennoch wird sich mit diesen Argumenten allein kein Konsens für substantielle Vermögens- und Erbschaftssteuern finden lassen. Warum? Verteilungspolitische Entscheidungen sind das Ergebnis von Verteilungskämpfen. Vermögenssteuern sind im Interesse derer, die ihr Einkommen überwiegend aus Arbeit und nicht aus Vermögen beziehen. Sie sind nicht im Interesse derer, die große Vermögen besitzen.
Wir könnten es mit dieser Feststellung bewenden lassen, und Fragen von „Gerechtigkeit“ und „moralischer Rechtfertigung“ als ideologische Verschleierung dieser grundlegenden Verteilungskämpfe beschreiben. Aber (verteilungs-)politische Konflikte werden auch und gerade auf der Ebene moralischer Diskussionen geführt und gewonnen. Die Linke muss verstehen, wie sich konservative und „Hausverstandsvorstellungen“ von Gerechtigkeit von ihren unterscheiden. Und sie muss die Inkonsistenzen und absurden Implikationen dieser Vorstellungen öffentlich thematisieren.
Historische Parallelen
Die verteilungspolitische Debatte ist natürlich nicht neu. In vielerlei Hinsicht erinnern aktuelle Argumentationslinien zum Thema, ob in Österreich oder international (etwa im Gefolge von Thomas Pikettys Buch „Capital in the 21st century“), an Argumentationslinien, die schon vor 200 Jahren die Diskussion prägten.
Der liberale, bürgerliche Mainstream der damaligen Zeit (insbesondere in Großbritannien) war stark vom Utilitarismus Jeremy Benthams geprägt, der die Maxime vom „größten Glück der größten Zahl“ aufstellte. Wenn es um verteilungspolitische Fragen ging, zogen sich bürgerliche Kommentatoren von so einer utilitaristischen Position auf eine Position in der Tradition John Lockes zurück. Locke sah Privateigentum und Verträge zwischen Privatparteien als natürliche und moralisch begründete Rechte (statt nur als möglicherweise nützliche Institutionen).
Benthams Maxime war nützlich für Liberale, weil sie eine Politik des Laisser-faire rechtzufertigen schien: Da alle Menschen am besten wissen, was für ihr eigenes Glück gut ist, scheint es nur logisch, möglichst wenig staatliche Vorschriften und Regeln zu haben, um zum größten Glück der größten Zahl zu finden. Eine Variante dieses Utilitarismus ist die Standardposition unter akademischen ÖkonomInnen bis heute. Varianten der Maxime vom „größten Glück der größten Zahl“ liegen aber auch den meisten linken und linksliberalen Positionen bis heute zugrunde –etwa in der Marx’schen „alle nach ihren Fähigkeiten, allen nach ihren Bedürfnissen“. Und das ist auch der Grund, warum der bürgerliche Mainstream schon vor 200 Jahren vor den Implikationen der utilitaristischen Position zurückschreckte. Radikale argumentierten schon damals, dass ein zusätzliches Pfund für Reiche weniger zusätzliches „Glück“ bringt als ein zusätzliches Pfund für Arme.
Wenn das stimmt, und wenn es unser Ziel ist, das größte Glück der größten Zahl zu erreichen, dann sollten wir von den Reichen zu den Armen umverteilen, bis alle gleich viel haben. Eine Schlussfolgerung, über die die Vertreter des vermögenden Bürgertums naturgemäß nicht sehr erfreut waren.
Fortsetzung folgt nächste Woche. In Teil 2 dieses Kommentars werden wir die moderne Variante der utilitaristischen Perspektive dem konservativen „Hausverstand“ gegenüberstellen. Der konservative Hausverstand sagt: „Was ich mit meinem Geld mache geht niemanden etwas an,“ und „Ich habe mir das hart erarbeitet, und jetzt soll mir das weggenommen werden?“ Wir werden diskutieren, auf welchen Annahmen solche Positionen beruhen und wie sie sich effektiv kritisieren lassen.
Nach einem Doktoratsstudium in Berkeley forscht und lehrt Maximilian Kasy derzeit an der Harvard University. Er beschäftigt sich unter anderem mit ökonomischer Ungleichheit, sozialer Mobilität, Steuern, Arbeitsmärkten, Bildung und städtischer Segregation.