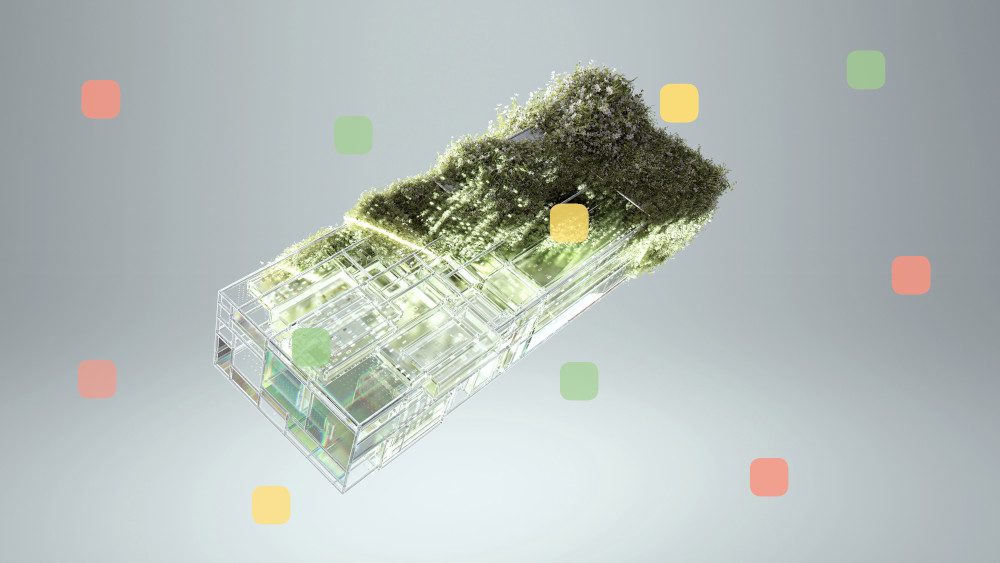Clemens Bergers jüngster Roman „Im Jahr des Panda“ führt entlang dreier Handlungsstränge durch die Sphären des postmodernen Kapitalismus. Mosaik-Redakteur Martin Birkner hat mit ihm über Reservepandas, literarische Produktionsbedingungen und die „sozialpartnerschaftliche Ästhetik“ gesprochen.
In deinem aktuellen Roman geht es um Pandas – und Geld. Was haben Pandas mit Geld zu tun?
Die Pandas dieser Welt sind ausnahmslos Eigentum der Volksrepublik China, die mit ihnen Politik und Diplomatie betreibt. Große Businessdeals werden mit Pandas als Draufgabe besiegelt. Also: Urandeals besiegelt mit Pandas. Die Pandas sind dann wiederum Publikumsmagneten in Zoos, lukrieren Einnahmen, werden von linksliberalen Politikerinnen und Politikern in die Kameras gehalten, während andererseits Haltung und Fütterung so kostspielig sind, dass es rein ökonomisch eher unrentabel erscheint. Gleichzeitig werden Pandas als „Flagship Species“ bezeichnet, sind also in der Hierarchie der Arten höher gestellt als andere Tiere. Zudem werden in China gewaltige Anstrengungen unternommen, die Spezies mit ausgeklügelten Zuchtprogrammen vom Aussterben zu bewahren, was nicht nur sehr erfolgreich ist, sondern auch neue Pandas erschafft, eine Armee von Reserverpandas, die andere Verhaltensweisen an den Tag legen als ihre Verwandten auf freier Wildbahn. Das alles schien mir eine prägnante Metapher für unsere Zeit.
In einem Interview hattest du gemeint, „Im Jahr des Panda“ wäre dein politischster Roman. Was macht für dich das Politische an Literatur aus?
Die Welt und die Gesellschaft in den Kämpfen und Konflikten zu zeigen, die die Menschen durchziehen und in ihnen wirken, auch wenn es ihnen oft nicht bewusst ist. Mir geht es weniger darum, zu zeigen, wie etwas sein sollte, als wie es ist. Wie Menschen in dieser Gesellschaft, die aus der Perspektive einer freien Gesellschaft als völlig absurd erscheinen muss, mit ihrer begrenzten Zeit auf diesem Planeten umgehen. So entstand eine Trilogie, von „Die Wettesser“ über „Das Streichelinstitut“ zu „Im Jahr des Panda“. Alle drei Romane adressieren Symptome des zeitgenössischen Kapitalismus. Wichtig ist mir, nicht etwas zu behaupten, sondern durch Charaktere und Zusammenhänge zu erzählen. Das darf auch unterhaltsam sein!
Die Arbeitsbedingungen der Hauptcharaktere – Künstler, Tierpflegerin, Bankomaten-Befüller_innen – sind untergründig stets präsent. Stehen sie stellvertretend für die Arbeitswelt des neoliberalen Kapitalismus?
Bei Pia und Julian war die Ausgangssituation, dass mir eine Bekannte von ihrem Job erzählte: nachts Bankomaten mit Geld zu befüllen, wobei sie die einzige Frau sei. Das gefiel mir, und mit der Vorstellung, Nacht für Nacht mit wahnsinnig viel Geld in einem gepanzerten Wagen unterwegs zu sein, während man selbst einen Hungerlohn verdient, taucht zwangsläufig der Wunsch auf, mit diesem Geld durchzubrennen und die Tat öffentlich zu zelebrieren. An der Tierpflegerin interessierte mich die Konstellation: Eine Frau, die Tag für Tag mit diesen wundersamen Geschöpfen zu tun hat, inmitten eines Zoos, der ja für die Welt in Form ihrer tierischen Exponenten steht, müsste einen anderen Blick auf die Welt haben als jemand, der sich mit Bürgerkriegen, Börse oder Politik beschäftigt. Einen sanfteren und friedlicheren – gelasseneren. Und bei Kasimir Ab, dem Künstler, geht es dann ums Eingemachte: Was ist Arbeit wert, wie wird dieser Wert gemessen, und was hat das mit der großen Blase des Kunstmarkts zu tun? Und was macht es mit einem, wenn das, was man malt, um sechsstellige Summen verkauft wird?
Dein Buch ist gewissermaßen auch ein internationales „Roadmovie“. Inwiefern ist das Ausdruck eines globalisierten Kapitalismus – oder wolltest du einfach gewisse Orte unterbringen?
Apulien, wohin Kasimir Ab mit seiner ehemaligen Therapeutin reist, ist eine Gegend, die ich sehr liebe, aber die Orte, an die Pia und Julian im Zuge ihrer Flucht kommen, ergeben sich beinahe zwangsläufig: Sie müssen weg aus Österreich, sich verstecken, sie brauchen eine neue Identität, sie landen dort, wo sich Kleinkriminelle am besten verstecken, also in Neapel, und am Schluss wollen sie in ein armes warmes Land, um mit ihrer halben Million in Ruhe leben zu können. So verschlägt es sie über Tunesien nach Vietnam.
Der Ausbruch des Künstlers Kasimir Ab und des Bankomat-Paares wird von dir gleichermaßen als politischer wie künstlerischer Akt beschrieben. Was kann politische Kunst heute noch leisten?
Der Begriff „politische Kunst“ hat einen seltsamen, etwas schalen Beigeschmack bekommen. Man denkt an Holzhammer oder flammendes Engagement in gerade brennenden Fragen, das zwar gut gemeint sein kann, aber künstlerisch wenig wertvoll ist. Das hat bestimmt auch einen Zeitindex, wenn wir etwa an die Sechziger Jahre denken. „Preaching to the converted“ finde ich nicht sonderlich reizend. Außerdem gibt es einen starken Zug in der Linken, Kunst auf politische Nützlichkeit abzuklopfen – das interessiert mich schon gar nicht, dabei kommt meistens schlechte Kunst oder moralische Selbstimmunisierung heraus. Da hatte schon Marx Recht, als er meinte, Balzac möge als Bürger ein Reaktionär sein, aber in seinen Romanen erweise er sich als Kritiker der bestehenden Verhältnisse – und zwar einzig und allein darin, dass er die Gesellschaft genau unter die Lupe nehme und beschreibe, wie sie sei. Jede Kunst ist politisch, ob sie will oder nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit stattfindet.
Robert Menasse hat 1990 die „Sozialpartnerschaftliche Ästhetik“ als „österreichischen Geist“ auch in der Literatur scharf kritisiert. Wirkt die Sozialpartnerschaft – vermittelt durch Literaturpreise und Stipendien – auch im literarischen Feld als Beruhigungsapparat?
Gegenfrage: Wenn der prototypische österreichische Künstler oder die prototypische österreichische Schriftstellerin etwas für untragbar hält, was tut er oder sie? Das Kulturministerium anrufen! „Die Politik“ um Hilfe bitten!
Warum sind die Bücher der österreichischen Autor_innen der jüngeren Generation oft so unpolitisch? Das war ja hierzulande nicht immer so …
Weil die einen nur nach Öffentlichkeit gieren und sich dabei — auch und gerade im Tabubruch oder sogenannten Skandal — der herrschenden Aufmerksamkeitsökonomie anpassen müssen. Und weil sich viele auf den Standpunkt stellen, sie seien bloß Autorinnen und Autoren und ihre Aufgabe sei es einzig und allein, Texte zu schreiben und hin und wieder Petitionen zu unterzeichnen, die zeigen, dass sie ohnehin auf der richtigen Seite stehen. Sie sind ja nicht unpolitisch, sie sind bloß konservativ. Sie verteidigen den Status Quo – auch und vor allem, wenn sie glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist die linksliberale Religion: Die Rechten sind böse, weil alles in allem ist es ja eh nicht so schlimm.
Zurück zu den Arbeitsbedingungen: Welche Verhandlungsmacht hat „der Autor als Produzent“ (Walter Benjamin) im heutigen kulturindustriellen Betrieb? Gibt es in einem stark individualisierten Bereich wie der Kunst so etwas wie Solidarität oder Widerstand überhaupt?
Ja, das gibt es schon, aber eher informell – oder, auf der anderen Seite, in Netzwerken, die einander mit Preisen, Stipendien und Auftritten stützen. Interessanter erscheint mir: Wenn ich sage, ich sei nicht automatisch mit anderen solidarisch, nur weil sie schreiben, werde ich als Fürsprecher des Neoliberalismus und der Entsolidarisierung attackiert. Aber wenn der eine Bäcker Kommunist und der andere Faschist ist – was haben sie miteinander zu tun, außer dass sie Brot und Semmeln backen? Hier herrscht ein abstruses Standesdenken.
Unter kapitalistischen Vorzeichen sind Autor_innen auf Einkünfte aus Verkäufen angewiesen, die wiederum von der Einhaltung von Copyright-Gesetzen abhängig sind. Andererseits sind wir als Linke an der freien Verbreitung des gesellschaftlich produzierten Wissens und Schaffens interessiert. Gibt es fortschrittliche Auswege aus dem Dilemma?
Den einzigen, den ich sehe, abgesehen von der Revolution, ist das bedingungslose Grundeinkommen: Es würde nicht nur Menschen davon befreien, jede noch so stupide Arbeit für noch so wenig Lohn anzunehmen – es würde auch viele Autorinnen und Autoren davon befreien, himmelschreienden Unfug zu schreiben, nur weil man annehmen kann, sie könnten in der Kulturindustrie reüssieren.
Du bist ja ursprünglich (Süd)Burgenländer. Wie wirkt sich die Regierungsbeteiligung der FPÖ auf die Kulturpolitik des Landes aus?
Verheerend. Aber es war, um ehrlich zu sein, auch vorher nicht besser. Die burgenländische Kulturpolitik verdient diesen Namen nicht — sie ist ein Anhängsel der Tourismusindustrie. Alles andere wird übersehen.
Clemens Berger, geboren 1979 im Südburgenland, studierte Philosophie in Wien, wo er als freier Schriftsteller lebt. Berger hat zahlreiche Romane und Erzählbände veröffentlicht.