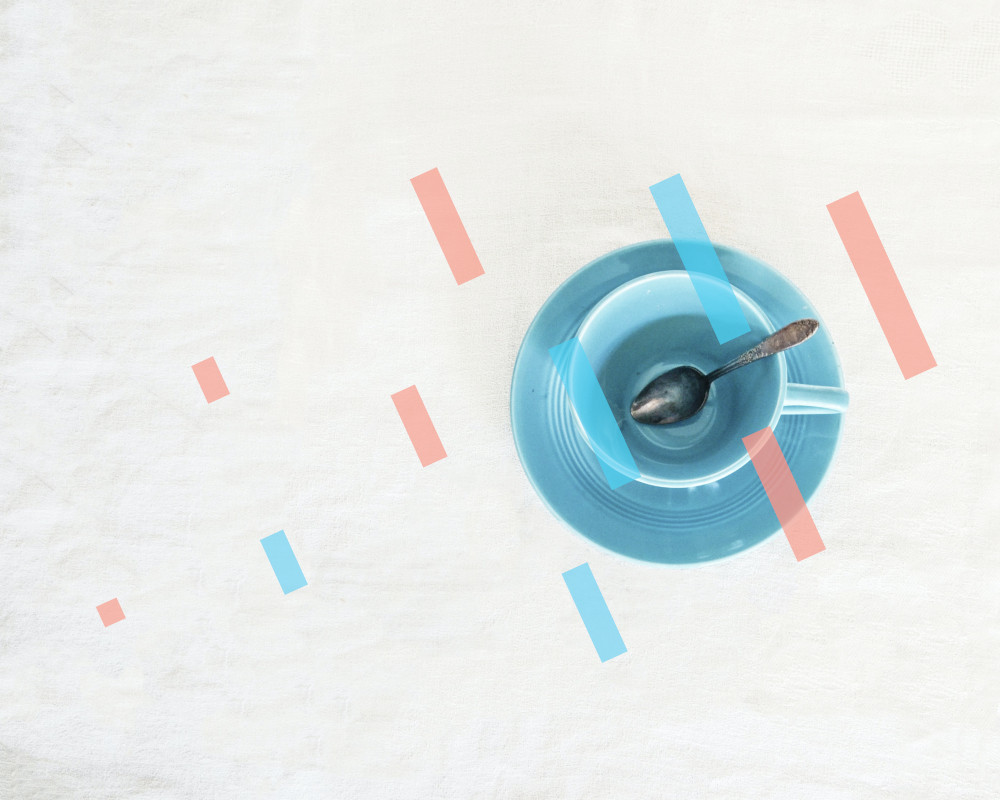17 Millionen Menschen sind weltweit am Chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankt. Trotzdem sind selbst Ärzt:innen mit der Krankheit meist nicht vertraut. Wirksame Medikamente und Unterstützungsstrukturen fehlen. Laura Kunz zu der Krankheit, die durch die Corona-Pandemie neue Aufmerksamkeit erlangte.
Mit der Zunahme der Long-Covid-Betroffenen ist auch die Aufmerksamkeit für die Erkrankung „Chronisches Fatigue Syndrom” (ME/CFS, Chronisches Erschöpfungssyndrom) gestiegen. Hauptsymptom der Krankheit ist ein massiver Energiemangel (Fatigue), der selbst den Gang zur Toilette zur Herausforderung machen kann. Oft wird die Symptomatik mit dem Gefühl eines anhaltenden grippalen Infekts verglichen. Zwei Prozent der 70.000 Long-Covid Patient:innen in Österreich sind ebenfalls von ME/CFS betroffen. Bekannt ist das Chronische Erschöpfungssyndrom jedoch schon deutlich länger als Long-Covid: Bereits 1969 erkannte die WHO es als chronische Erkrankung an. Die Einschränkung der Lebensqualität ist bei dieser Krankheit besonders massiv. Etwa 25 Prozent der Betroffenen sind ans Bett gefesselt. Nur ein Viertel der Betroffenen kann eingeschränkt einer Erwerbsarbeit nachgehen. Die österreichische Gesellschaft für ME/CFS geht derzeit von 26.000 bis 80.000 Erkrankten in Österreich aus.
Trotzdem ist die Krankheit selbst Mediziner*innen kaum bekannt. Betroffene und deren Vertreter:innen fordern daher seit Jahren spezialisierte Anlaufstellen und Versorgungszentren, mehr Aufklärungsarbeit von Seiten der Politik und vor allem mehr Forschungsgelder. Denn bis heute gibt es keine Behandlung für das Chronische Erschöpfungssyndrom. Die erste Zulassungsstudie für ein Medikament wurde erst im Oktober 2022 freigegeben.
Aktivismus unter erschwerten Bedingungen
Aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit versuchen viele Betroffene, die Aufklärung zu ME/CFS selbst in die Hand zu nehmen und beispielsweise Gelder für die Entwicklung von Medikamenten zu sammeln. Dies geschieht meist über Social Media Plattformen da, wie zu erwarten, für andere Formen des Aktivismus oft die Kraft fehlt. Die Wissenschaftlerin Emily Lim Rogers beschreibt dieses Paradox sehr prägnant: „Aktivismus bedeutet Aktion, und Menschen mit ME/CFS können diese nicht umsetzen“. Dabei unterscheidet sich Online-Aktivismus nicht nur formal von Aktivismus auf der Straße. Online-Protest zeichnet sich oft durch eine eher kooperative Haltung aus. Nicht durch kollektive Opposition, die Forderungen mit Nachdruck stellen kann.
So kommt es bei Patient Activism generell immer wieder zu Zusammenarbeit zwischen Erkrankten und Pharmaunternehmen. Doch während den einen vor allem an einem schnellen Zugang zu wirksamen Medikamenten gelegen ist, hat für die anderen Profitmaximierung oberste Priorität. Zudem wird die Zusammenarbeit mit erkrankten Menschen zum Teil zu Marketing-Zwecken für sogenanntes „Pink Washing“ missbraucht.
Die kranke Einzelperson im Mittelpunkt
Ein weiteres Merkmal des Online-Aktivismus ist, dass dabei oftmals das Schicksal von Einzelpersonen im Vordergrund steht. Das „kranke Ich“ wird zu einem sehr zentralen Bezugspunkt, um die eigenen Anliegen zu kommunizieren. Die eigene Betroffenheit in den Vordergrund zu stellen, um dadurch Aufmerksamkeit zu gewinnen und Veränderungen anzustoßen, ist eine übliche Herangehensweise.
Von Betroffenen und ihrem Umfeld wird ein solches Vorgehen manchmal sogar als Verpflichtung empfunden. Oft sehen sie die Bezugnahme auf das „kranke Ich“ als einzige Option, um auf die katastrophale Versorgungslage aufmerksam zu machen. Gleichzeitig müssen sich erkrankte Menschen, die sich trotz ihrer Einschränkungen aktivistisch engagieren und als Einzelpersonen auftreten, immer öfter Vorwürfe anhören: Sie würden narzisstisch handeln und aus ihrer Situation Eigenkapital schlagen.
Individualisierung des Chronischen Erschöpfungssyndroms
Dass die strukturelle Gesundheitsversorgung versagt und Betroffene versuchen, innerhalb ihrer Möglichkeiten Verbesserung herbeizuführen, wird hier absurderweise zu einem Vorwurf verkehrt. Ein Vorwurf an jene, die sich die Individualisierung ihrer Situation nicht ausgesucht haben, sondern diese durchbrechen wollen. So wurde etwa Long Covid erst dadurch erkannt, dass sich Betroffene über Online-Medien geäußert und ausgetauscht haben.
Auch für das Chronische Erschöpfungssyndrom gilt, dass die Individualisierung der Betroffenen durch die fehlende Versorgungsstruktur, durch „fehlendes” Wissen und fehlende Anerkennung verursacht wird. Erkrankte und ihre Unterstützer:innen müssen sich um ihre Behandlung kümmern, müssen sich Know-How zusammensuchen, müssen behandelnde Ärzt:innen über ihre Krankheit informieren. Sogenanntes Medical Gaslighting ist Alltag. Dieses Problem betrifft leider nicht nur an Long Covid- und/oder ME/CFS erkrankte Menschen.
Was es braucht
Was es braucht, ist die Schaffung und Finanzierung von Strukturen, die Zusammenarbeit mit Betroffenen ermöglichen. Dazu gibt es tolle Beispiele aus der Medizingeschichte. Zum Beispiel die Act Up Bewegung der 1980er, die die Zusammenarbeit zwischen HIV-Erkrankten und Mediziner*innen möglich machte. Es gibt auch heute schon Ansätze dazu in der ME/CFS Forschung. Etwa das 2021 gestartete Projekt „Computer-based Clustering of Chronic Fatigue Syndrome Patients” an der medizinischen Universität Wien. Hier wird eng mit Betroffenen zusammengearbeitet.
Kein Wille zu engerer Zusammenarbeit mit Betroffenen ist hingegen von Seiten der Politik zu erkennen. Letztes Jahr startete die österreichischen Gesellschaft für ME/CFS eine Petition, in der sie, neben Aufklärung und Aufbau medizinischer Behandlungs- und Versorgungsstrukturen, auch die soziale Absicherung Betroffener sowie höhere Forschungsförderungen forderte. Doch die Petition blieb folgenlos. Die Sozialversicherungsträger verweigerten eine formal gültige Stellungnahme, welche für eine Behandlung im Petitionsausschuss des österreichischen Parlaments notwendig wäre. Die Begründung: Man wisse zu wenig über die Krankheit.
Dabei fehlt es nicht grundsätzlich an Wissen. Betroffene wissen sehr viel über die Krankheit. Auch die Handvoll engagierter Mediziner*inne, die sich um ihre Patient*innen und Fortschritte in der Forschung bemühen, wissen viel. Die Vernetzung dieser Wissensbestände findet statt. Doch die Politik unterstützt die Vertiefung dieses Wissens nicht. Das zu ermöglichen, ist Aufgabe der Gesundheitspolitik. Nicht die Verantwortung derjenigen, die darum kämpfen, ihren Alltag zurückzugewinnen.
Foto-Credit: Debby Hudson