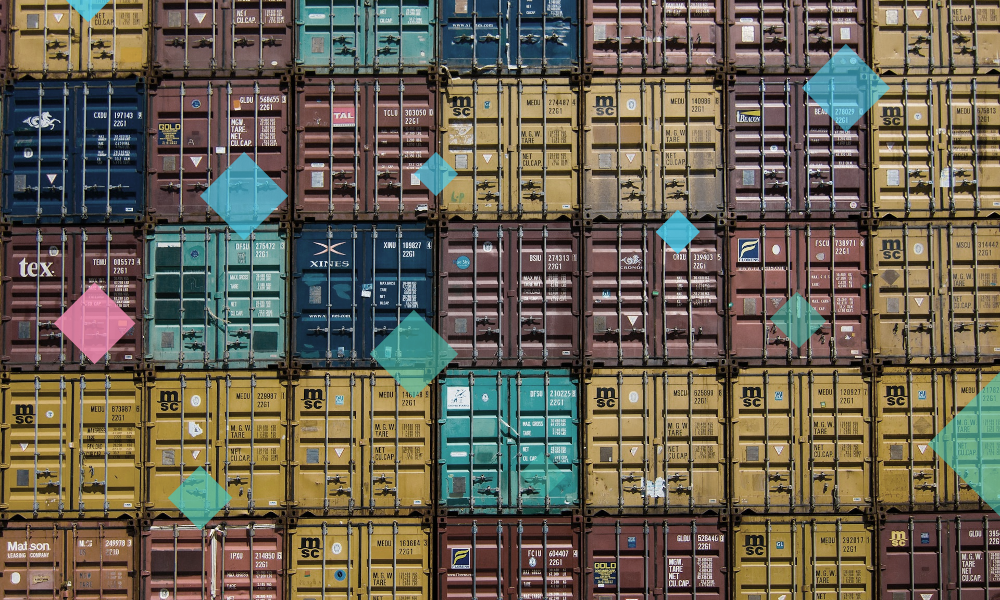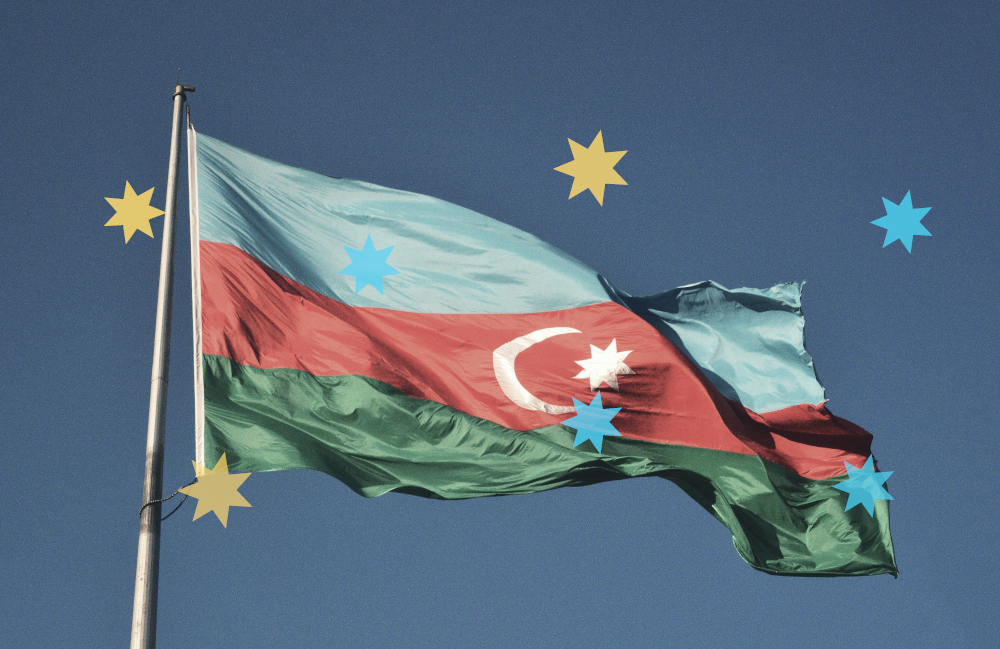Sahra Wagenknecht will eine linke Mehrheit in Deutschland sammeln – und spaltet damit die linke Öffentlichkeit. Die einen sehen in der „Sammlungsbewegung“ Aufstehen eine nationalistische Gefahr, die anderen die einzige Chance, die Linke bei Wahlen über das Maximum von zehn Prozent zu bringen. Wir haben mit Ines Schwerdtner und Loren Balhorn, RedakteurInnen des neuen Magazins Ada, über die unübersichtliche Lage der Linken in Deutschland gesprochen.
mosaik: Vor einigen Tagen wurde die Sammlungsbewegung Aufstehen der Öffentlichkeit präsentiert. Angeführt von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, unterstützt von mehreren Abgeordneten und FunktionärInnen der Linkspartei. Warum sind diese Leute denn so unzufrieden mit ihrer eigenen Partei, dass sie ein neues Projekt starten?
Ines Schwerdtner: Vor allem sind sie unzufrieden, dass man vom langsamen Untergang der SPD nicht profitiert. Deshalb versuchen sie jetzt, sozialdemokratische Politik zu rehabilitieren. Für die Linke müsste so ein neues sozialdemokratisches Projekt aber keine große Gefahr sein.
Loren Balhorn: Auch viele SPDlerInnen wissen wohl insgeheim, dass ihre Chancen, wieder eine bestimmende Rolle in der Politik jenseits der großen Koalition zu spielen, ohne so etwas wie Aufstehen sehr gering sind. Wenn die Sammlungsbewegung eine Dynamik anstößt und eine Diskursverschiebung hin zu sozialdemokratischen Positionen gelingt, könnte ihnen das den Arsch retten.
Spannender finde ich aber, dass Aufstehen einen Widerspruch in der Linken selbst auf die Tagesordnung setzt. Nämlich, dass die Linkspartei für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre keine Machtperspektive hat. Bisher gab es einen Flügel in der Partei, für den klar ist, wie darauf zu antworten ist: Sie wollen Regierungsbeteiligungen um fast jeden Preis.
Der andere Flügel hat sich bisher nur in Abgrenzung zu diesem Flügel definiert. Dabei haben sie sich viele Jahre lang auf Sahra Wagenknecht berufen. Aufstehen bringt diese Konstellation total durcheinander und wird zu interessanten neuen Debatten in der Linkspartei führen.
Ist das Ziel von Aufstehen also, eine rot-rot-grüne Regierungskoalition herbeizubewegen?
Ines: Ich glaube, das ist ein Ziel. Vor allem aber wollen sie anscheinend bisher politisch nicht aktive oder enttäuschte Leute für ein linkes Projekt gewinnen. Das hat erstmal nichts mit Wahlen zu tun. Ob das dann in parteipolitische Machtoptionen überführt werden kann, ist noch offen. Im Moment ist Aufstehen nicht mehr als ein großer Email-Verteiler. Ob die Menschen, die sich dafür anmelden, auch tatsächlich politisch aktiv werden, ist die entscheidende Frage.
Loren: Viele KritikerInnen des Projekts spekulieren, dass es Sahra Wagenknecht eigentlich darum ginge, eine eigene Partei zu gründen. Dass sie die Partei verlässt, die sie trotz allem dreißig Jahre lang aufgebaut hat – erst in der PDS, dann in der Partei Die Linke –, glaube ich aber eher nicht.
Aufstehen ist bisher vor allem eine Homepage und ein Newsletter. Angeblich haben sich innerhalb weniger Tage über 50.000 Menschen eingetragen. Weiß man, was die Menschen dazu bringt und was sie sich von Aufstehen erwarten?
Ines: Ich denke, es ist wie in anderen Ländern auch: Klassische Parteien sind für viele Menschen nicht mehr attraktiv, weil sie mit bürokratischen Apparaten und der ganzen Art, wie Politik heute gemacht wird, identifiziert werden. Damit wollen viele nichts zu tun haben. Aufstehen bietet etwas anderes an. Vor allem Leute, die von SPD, Grünen und vielleicht auch von der Linken enttäuscht sind, sollen da eine Stimme bekommen. Oder zumindest mal gehört werden.
Aber das birgt natürlich die Gefahr, dass jemand wie Sahra Wagenknecht als Heilsbringerin gesehen wird. Als würde es reichen, sich irgendwo einzutragen und dann wird mein Leben besser, meine Miete niedriger und mein Lohn höher.
Loren: Wenn man die Facebook-Profile der Leute ansieht, die Aufstehen unterstützen, fällt auf, dass sie aussehen wie stinknormale Bundesbürger in durchschnittlichen, mittelgroßen deutschen Städten. Die kommentieren dann so etwas wie „Endlich bewegt sich was!“. Offenbar trifft Aufstehen hier etwas. Politik- und Parteienverdrossenheit ist ja ein reales Phänomen. Nicht nur in Deutschland, sondern in Demokratien überall auf der Welt. Darauf muss man auch als Linke eine Antwort finden.
Als ich noch in den USA gelebt habe, habe ich so etwas bei der Wahlkampagne von Barack Obama erlebt. Da ist eine Dialektik zwischen Basis und Führung entstanden. Natürlich war das eine top-down initiierte Kampagne. Ein kleiner Kreis hat sie konzipiert und geplant, hat ein Medienimage und ein Design entwickelt und die organisatorische Infrastruktur aufgebaut. Aber das geht nur auf, wenn die Kampagne sich mit Impulsen von unten verbindet und ein Eigenleben entwickeln kann.
Die Obama-Kampagne war von oben nach unten durchstrukturiert und hierarchisch organisiert. Trotzdem haben darin hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen von sich aus mitgemacht und die Kampagne durch ihre eigene Initiative viel größer und dynamischer gemacht.
Das gleiche haben wir seither bei Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn gesehen. Das muss man weder gut noch schlecht finden. Das ist einfach so. Es gibt keine Bewegung, die spontan, von unten, ohne vorherige Absprache und Organisierung stattfindet.
Auch bei Aufstehen wird es darauf ankommen, wie viel Energie von unten einfließt, wie viele Menschen ihre eigenen Dinge einbringen und wie weit die Führung bereit ist, Eigeninitiative zu begrüßen und zuzulassen.
Die „stinknormalen Bundesbürger“, die Aufstehen bislang unterstützen, sind allem Anschein nach vor allem weiße Deutsche mit deutsch-deutschen Namen. Auf der Homepage werden Videos mit „Bürgerinnen und Bürgern“ präsentiert, die „Susi“, „Andi“, „Rolf“ und „Kurt“ heißen. Die reale Vielfalt der deutschen Gesellschaft findet sich da nicht wieder. Das ist wohl kein Zufall. Sahra Wagenknecht polemisiert schon lange gegen eine Politik der offenen Grenzen. In einem Zeitungsbeitrag gemeinsam mit dem Aufstehen-Unterstützer Bernd Stegemann schreibt sie: „Die politisch sinnvolle Grenze verläuft nicht zwischen den Ressentiments der AfD und der allgemeinen Moral einer grenzenlosen Willkommenskultur. Eine realistische linke Politik lehnt beide Maximalforderungen gleichermaßen ab.“ Das ist doch ein klares Zugeständnis an die rassistische Rechte, oder?
Ines: Es ist jedenfalls ein Versuch, des Rechtsrutschs Herr zu werden. Die Strategie scheint darauf angelegt, jene anzusprechen, die aus Frust und Protest AfD wählen. Dabei entstehen problematische Ambivalenzen. Denn dann musst du immer den Diskurs beherrschen, damit der nicht ganz nach rechts abdriftet. Ich bin skeptisch, ob ihnen das gelingt.
Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass Aufstehen nicht versucht, schon existierende Bündnisse, Bewegungen und Initiativen mitaufzunehmen. Denn die sind überwiegend antirassistisch oder feministisch aufgestellt. Dabei könnte eine klarere antirassistische und feministische Position das Projekt stärken.
Inhaltlich ist das Projekt aber natürlich sehr stark auf den Nationalstaat bezogen. Man will den Sozialstaat als Nationalstaat wiederhaben. Das ist für sich genommen nicht rechts. Aber es hat ein reaktionäres Potenzial, weil es dann ja darum geht, wie dieser Nationalstaat begrenzt wird.
Loren: Wobei es mich nicht überrascht, dass sie keine anderen linken Bewegungen ansprechen. Sahra Wagenknechts Sorge ist, dass die bestehende Linke die angebliche schweigende sozialdemokratische Mehrheit im Land nicht mehr ansprechen kann. Aufstehen soll das leisten.
Ich würde aber erstmal abwarten, was genau in dem Programm steht, das am 4. September präsentiert werden soll. Anscheinend sollen manche der problematischen Formulierungen zu Migration und Grenzpolitik rausgenommen werden, was als Linksverschiebung innerhalb von Aufstehen gewertet werden kann.
Viel wichtiger finde ich aber, was danach passiert. Bei der Kampagne rund um Bernie Sanders war es anfangs ähnlich. Er hatte ein sehr ökonomistisch zugespitztes Programm, hat kaum etwas über Rassismus gesagt. Viele Linke haben ihm das damals vorgeworfen. Bernie war aber in der Lage, auf Kritik einzugehen Er hat seine Positionen verschoben, Veranstaltungen mit Schlüsselfiguren der antirassistischen Bewegungen gemacht. Heute, drei Jahre später, erinnert sich keiner mehr daran, dass es mal hieß: „Bernie interessiert sich nur für weiße Männer“.
Damit will ich nicht sagen, dass die Kritik an Sahra Wagenknecht nicht berechtigt wäre. Aber sie und die anderen führenden Figuren in Aufstehen sind nicht dumm. Sie wissen, dass sie die Politik in Deutschland nicht alleine verändern werden. Dafür werden sie neue Themen und Forderungen aufgreifen müssen.
Initiativen wie die #Seebrücke-Mobilisierungen könnten durchaus als Korrektur wirken, so dass Aufstehen lernt, Rassismus stärker zu thematisieren und in seine Erzählung einzubetten. So wie es bei Black Lives Matter und Bernie Sanders der Fall war. Man sollte das als dynamische Sache begreifen, nicht das Ende vom Anfang her denken.
Ihr habt die Online-Zeitschrift Ada gegründet, einer euer Slogans ist: „Wir wollen nicht Recht haben, sondern gewinnen“. Was würde es denn bedeuten, zu „gewinnen“? Ist euer „gewinnen“ das gleiche, was Sahra Wagenknecht und Aufstehen sich unter „gewinnen“ vorstellen?
(Beide lachen)
Ines: Wahrscheinlich wollen wir nicht das gleiche. Aber natürlich haben wir alle die Angst, dass Deutschland komplett nach rechts kippt und es wie in Österreich eine rechte, autoritäre Regierung gibt. Vor diesem Hintergrund ist jede linke Bewegung, die versucht, das zu verhindern, erstmal gut.
Am Ende sind wir aber sehr unterschiedlicher Auffassung, was die Herangehensweise angeht. Wir wollen kleine linke Erfolge sichtbar machen: gelungene Streiks, neue Organisierungen, das Zurückgewinnen von Terrain in der Kultur.
Vor ein paar Jahrzehnten hatte die Linke noch eine Vorstellung davon, was sie erreichen will, und ist an der Umsetzung gescheitert. Heute fehlt ihr oft die Idee, wo sie überhaupt hin will. Ada möchte, ähnlich wie das Schwestermagazin Jacobin in den USA, zeigen, wie es anders sein könnte. Wie könnte man denn heute zu den großen Erfolgen kommen?
Loren: In Deutschland sind wir in einer besonders kuriosen Situation. Trotz aller Verschlechterungen scheint man hier noch relativ gut dazustehen. Die Arbeitslosigkeit ist relativ gering, der Lebensstandard relativ hoch, die extreme Rechte hat 15 Prozent, aber immerhin keine 50. Es erstaunt mich immer wieder, dass vielen eigentlich vernünftigen Linken nicht bewusst ist, dass wir auf einem Vulkan tanzen. Sie begreifen nicht, wie gefährlich die Lage in Deutschland ist. Die AfD ging von 4 auf 15 Prozent in vier Jahren. Warum sollte sie nicht in weiteren vier Jahren auf 30 Prozent kommen?
Gewinnen würde erstmal bedeuten, dass wir nicht mehr verlieren. Schritt eins ist, nicht so zu werden wie Österreich. Da könnte Aufstehen tatsächlich eine positive Rolle spielen. Vielleicht schaffen sie es, eine diskursive Verschiebung zu erreichen. So wie die AfD die konservativen Parteien CDU und CSU nach rechts zieht, könnte Aufstehen SPD und Grüne nach links ziehen.
In einem nächsten Schritt müssten wir überlegen, was es bedeuten könnte, auf europäischer Ebene zu gewinnen. Deutschland profitiert von allen Staaten am meisten von der EU. Die deutsche Linke müsste also überlegen, wie die europäischen Strukturen so verändert werden können, dass Länder wie Griechenland, Italien oder Spanien nicht auf alle Ewigkeit zu Armut und Prekarität verdammt sind. Ob innerhalb oder außerhalb der EU. Wir müssen uns durch Reformen innerhalb des kapitalistischen Systems etwas Raum und Zeit verschaffen, um die wirklich großen, drängenden Fragen anzugehen.
Die größte davon ist die Klimakatastrophe. Wenn wir es nicht schaffen, in relativ kurzer Zeit die kapitalistischen Regierungen zu zwingen, massive Umrüstungspläne umzusetzen, die eine nachhaltige, erneuerbare Wirtschaftsgrundlage schaffen, können wir das mit dem Sozialismus sowieso vergessen.
Wenn wir nur über die Prinzipien einer solidarischen, sozialistischen Gesellschaft der Zukunft nachdenken, übersehen wir, welche unmittelbaren nächsten Schritte wir setzen müssen, um überhaupt in die Nähe einer solchen Zukunft zu kommen. Wir stehen schließlich heute vor Weggabelungen, die letztendlich über die Zukunft oder Nicht-Zukunft der menschlichen Zivilisation überhaupt entscheiden könnten.
Interview: Benjamin Opratko